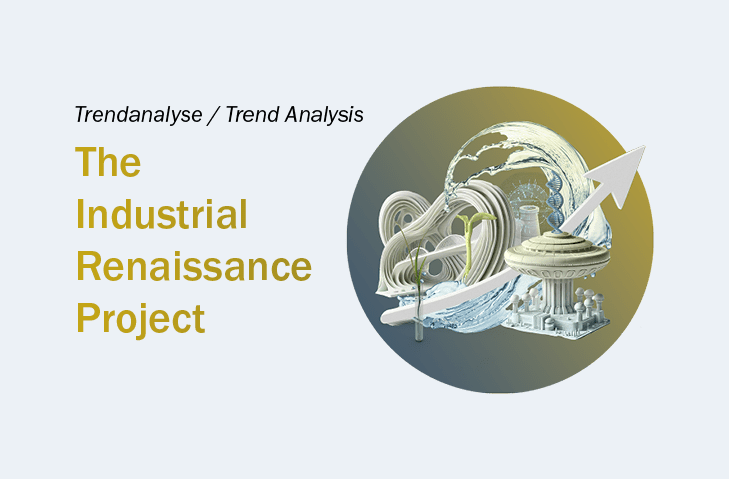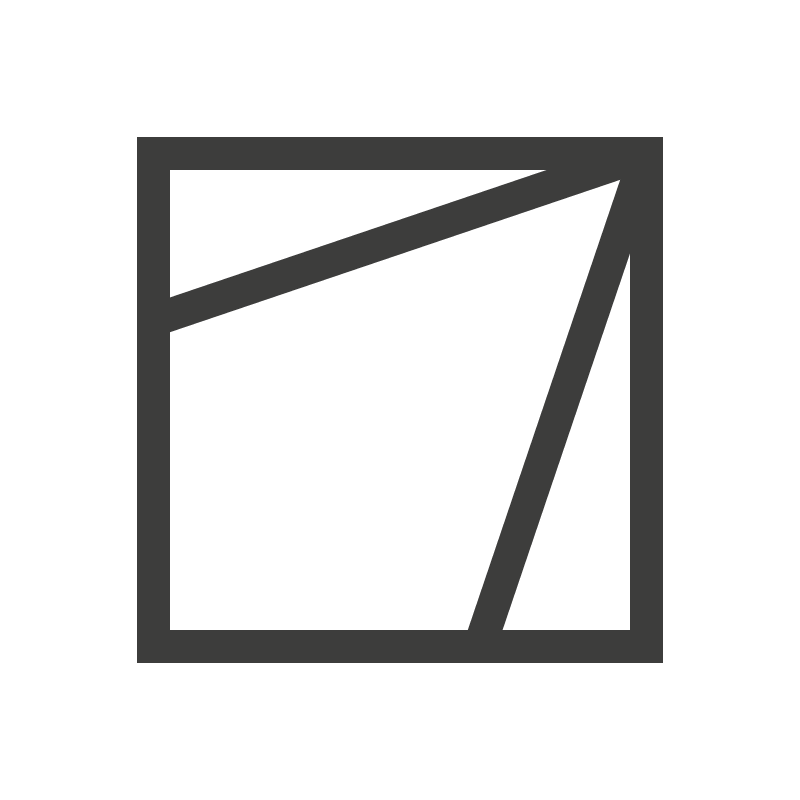2: Konturen zukünftiger Industrien
Industrial Renaissance Project – Teil 2
Worum geht es in diesem Projekt in Kürze?
Das Industrial Renaissance Project von Themis Foresight ist eine mehrjährige, offene Zukunftsinitiative zur Neudefinition industriellen Wachstums im 21. Jahrhundert. Ziel ist es, ein regeneratives, globales und zukunftsfähiges Industriesystem zu entwerfen – jenseits der zerstörerischen Muster des fossilen Zeitalters. Das Projekt umfasst weltweite Experteninterviews, interaktive Future Labs, wissenschaftlich fundierte Veröffentlichungen und Kooperationen mit renommierten Forschungseinrichtungen.
Einleitung: Von falschen Entscheidungen zu regenerativem Wachstum
Die industrielle Zivilisation steht an einem Scheideweg. In Teil 1 dieser Serie habe ich argumentiert, dass die polarisierte Debatte zwischen „Degrowth“ und „grünem Wachstum“ ein falsches Dilemma ist. Degrowth, die Forderung nach einer bewussten Schrumpfung der Volkswirtschaften, führt zu sozialen Verteilungskämpfen und verarmt die Entwicklungsländer. Grünes Wachstum hingegen hofft entgegen aller Vernunft, dass wir das BIP von den ökologischen Auswirkungen entkoppeln können. Beide Ansätze, wie sie typischerweise präsentiert werden, greifen zu kurz – der eine bedroht den Wohlstand, der andere riskiert ein „Greenwashing“ des Status quo. Die Schlussfolgerung von Teil 1 war, dass wir einen anderen Weg brauchen: ein regeneratives industrielles Wachstum, das den wirtschaftlichen Wohlstand steigert und gleichzeitig die lebenswichtigen Kreisläufe des Planeten wiederherstellt.
Diese „industrielle Renaissance“ bedeutet, anders zu wachsen, nicht, das Wachstum zu stoppen. Es bedeutet, die Industrie so umzugestalten, dass sie im Einklang mit den Kohlenstoff-, Stickstoff-, Phosphor-, Wasser- und anderen Kreisläufen der Erde arbeitet – und nicht gegen sie. Wir haben gesehen, wie das derzeitige lineare Modell des Nehmens, Herstellens und Wegwerfens gegen diese natürlichen Zyklen verstößt und zu Klimawandel, Umweltverschmutzung und Ressourcenerschöpfung führt. Eine einfache Verlangsamung (Degrowth) oder eine geringfügige Ökologisierung der derzeitigen Praktiken wird diese Probleme nicht lösen. Wir brauchen ein industrielles System, das von vornherein auf die Regeneration von Ökosystemen ausgerichtet ist: zirkulär, kohlenstoffarm und in Symbiose mit natürlichen Stoffkreisläufen. Dies zu erreichen, ist nicht nur eine Frage der Politik oder der Verhaltensänderung – es erfordert Innovation. Und zwar nicht nur die bekannte Art der „digitalen Innovation“ bei Apps oder Dienstleistungen, sondern Durchbrüche in den Kernbereichen der „realen“ Wirtschaft: wie wir Stahl und Zement herstellen, Lebensmittel anbauen, Chemikalien produzieren und Städte bauen.
Wenn wir uns heute umsehen, stellen wir fest, dass wir genau dort ein Innovationsdefizit haben, wo es am wichtigsten ist. Wir leben in einer Zeit, in der Software ganze Welten simulieren kann, aber wir kämpfen immer noch damit, 8 Milliarden Menschen nachhaltig zu ernähren. Wir können Genome sequenzieren und KI-Modelle trainieren, aber wir verbrennen immer noch dieselben fossilen Brennstoffe und synthetisieren Düngemittel wie unsere Großeltern. Teil 1dieses Artikels endete mit dem Aufruf, „vom Schrumpfen zum Bauen“ überzugehen – den menschlichen Einfallsreichtum auf eine industrielle Wiederbelebung auszurichten, die den Planeten heilt. In diesem Teil 2 greifen ich dieses Bild auf. Ich werde darlegen, warum kritische Branchen bei der Innovation zurückgeblieben sind und wie sich dies rasch ändert. Ich werde einen Überblick über aufkommende Technologien geben – von fossilfreiem Stahl bis hin zu „Schwammstädten“ – die den Weg zu einer planetenverträglichen Wirtschaft weisen. Ich werde auch die Lücken bewerten, in denen noch transformative Lösungen benötigt werden (z. B. Kohlenstoffabscheidung in großem Maßstab oder Nährstoffrecycling) und wie Initiativen wie das Industrial Renaissance Project von Themis Foresight dazu beitragen können, diese Lücken zu schließen.


Diese Analyse unterstreicht vor allem, dass Innovation – echte, physische, technologische Innovation – der Dreh- und Angelpunkt für eine nachhaltige industrielle Zukunft ist. Politische Reformen und Konsumverlagerungen sind wichtig, aber ohne neue Technologie und Technik werden sie nicht ausreichen. Wir können unseren Weg aus dem Klimawandel nicht allein mit Software programmieren; wir müssen neue Maschinen, Prozesse und Infrastrukturen im Herzen unserer Wirtschaft erfinden. Teil 2 wird zeigen, dass diese neuen Erfindungen bereits im Gange sind und von Pionieren auf der ganzen Welt vorangetrieben werden, und skizzieren, wie wir sie beschleunigen können.
Das Innovationsdefizit: Warum die Schwerindustrie hinterherhinkt
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Innovation stark auf die Informationstechnologie und die Unterhaltungselektronik konzentriert, während viele industrielle Kernprozesse bemerkenswert unverändert geblieben sind. Der umstrittene Investor Peter Thiel witzelte einmal in Anspielung auf Twitter: „Wir wollten fliegende Autos, stattdessen erhielten wir 140 Zeichen“. Das ist ein echtes Ungleichgewicht: Die Gesellschaft hat Talente und Kapital in den digitalen Bereich gesteckt und exponentielle Fortschritte bei der Rechenleistung und den Daten erzielt, während sich Basisindustrien wie Stahl, Zement, Chemie und Landwirtschaft nur im Schneckentempo entwickelt haben. Wir können ein Auto über eine App herbeirufen, aber das Auto läuft meistens noch mit einem Verbrennungsmotor, der Öl verbrennt. Wir haben Cloud Computing und KI, aber die globale Stahlindustrie stößt immer noch über 2,6 Gigatonnen CO₂ pro Jahr aus, und zwar mit Methoden, die im Wesentlichen denen aus der Mitte des 20.


Dazu ein paar Vergleiche. Im Jahr 1969 hatte der Apollo-11-Computer etwa 4 KB Speicherplatz; heute ist Ihr Smartphone millionenfach leistungsfähiger – ein Ergebnis unermüdlicher Innovationen bei Halbleitern. Im Gegensatz dazu ist die Art und Weise, wie wir Ammoniakdünger herstellen (das Haber-Bosch-Verfahren), im Wesentlichen das gleiche Verfahren, das 1908 erfunden wurde und fossile Brennstoffe verschlingt und CO₂ erzeugt. Mehr als 80 % des weltweiten Stickstoffdüngers stammen immer noch aus dem Haber-Bosch-Verfahren. Zement – das Mischen von Kalkstein und Ton, das Brennen in einem Ofen – ist aufgrund der Chemie der Kalzinierung nach wie vor ein unvermeidlicher CO₂-Emittent. Diese Sektoren haben ihre Effizienz im Laufe der Zeit sicherlich verbessert, aber die zugrunde liegenden Prozesse haben sich nicht so radikal verändert wie die Mikrochips oder die Kommunikation.
Warum dieses Innovationsdefizit in der Schwerindustrie? Mehrere systembedingte Hindernisse sind zu nennen:
Wirtschaftliche und finanzielle Hürden: Die Entwicklung und Einführung neuer Technologien in der Stahl- oder Zementindustrie ist weitaus kapitalintensiver und riskanter als die Einführung einer neuen Softwareplattform. Ein einziges neues Stahlwerk kann Milliarden von Dollar kosten; die etablierten Unternehmen scheuen sich davor, auf unerprobte Verfahren zu setzen, die möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Die Gewinnspannen bei Rohstoffen sind oft gering, so dass wenig Spielraum für Investitionen in Forschung und Entwicklung bleibt oder das Risiko von Betriebsstörungen in Kauf genommen wird. Hinzu kommt das klassische Problem der externen Effekte: Da die Umweltkosten (Kohlendioxidemissionen, Umweltverschmutzung) in der Vergangenheit nicht oder zu niedrig bepreist wurden, gab es kaum Marktanreize für Innovationen im Sinne der Nachhaltigkeit. Es war billiger, die alte, umweltschädliche Technik weiter zu verwenden.
Gesetzliche Vorschriften und Normen: Industrielle Sektoren sind in Bezug auf Sicherheit und Qualität stark reguliert (aus gutem Grund). Bauvorschriften, technische Normen und Zertifizierungsprotokolle neigen dazu, bekannte Materialien und Verfahren zu bevorzugen. So wird beispielsweise ein neuartiger kohlenstoffarmer Zement von den Bauvorschriften nicht ohne weiteres akzeptiert, solange er sich nicht über viele Jahre hinweg bewährt hat. Dies kann zu einem konservativen, sich langsam verändernden Umfeld führen. Ähnlich ist es in Branchen wie der Chemie- oder Lebensmittelbranche, die streng reguliert sind, um die Produktreinheit und -sicherheit zu gewährleisten; die Einführung biobasierter oder recycelter Rohstoffe kann auf regulatorische Hürden stoßen. Vorschriften können so ungewollt veraltete Technologien erstarren lassen, wenn sie nicht aktualisiert werden, um Innovationen zu fördern.
Technologische Komplexität: Manche Probleme sind einfach schwierig. Die Dekarbonisierung von Zement oder Flugbenzin ist eine größere technische Herausforderung als die Verbesserung eines Smartphones pro Jahr. Grundlegende wissenschaftliche Beschränkungen können schnelle Erfolge begrenzen – z. B. kann man die Tatsache nicht ändern, dass beim Erhitzen von Kalkstein CO₂ als Nebenprodukt freigesetzt wird, es sei denn, man findet einen Weg, es abzuscheiden oder eine andere Chemie zu verwenden. Wenn man Getreidepflanzen beibringen will, ihren eigenen Stickstoff zu fixieren (wie es Hülsenfrüchte tun), sind ebenfalls Durchbrüche in der Gentechnik erforderlich, an denen Wissenschaftler seit Jahrzehnten arbeiten. Die niedrig hängenden Früchte im Bereich der industriellen Effizienz wurden schon vor langer Zeit gepflückt; was bleibt, sind inhärent schwierige Probleme, die multidisziplinäre Innovation erfordern (Materialwissenschaft, Biologie, Chemie, Technik).
Kulturelle und talentbezogene Faktoren: In den letzten Jahrzehnten lag die Anziehungskraft für viele Spitzeningenieure und Unternehmer in den Bereichen Software, Finanzen oder Biotechnologie. Silicon Valley, nicht „Smokestack Valley“. Der Industriesektor litt unter einem Wahrnehmungsproblem – er galt als schmutzig, altmodisch oder langsam -, was es schwieriger machte, neue Talente und Risikokapital anzuziehen. Dies beginnt sich mit dem Aufschwung der Climate-Tech-Investitionen zu ändern, aber lange Zeit hätte sich ein brillanter Chemieingenieur vielleicht eher für die Arbeit an pharmazeutischen Katalysatoren (hohe Gewinnspanne) als für die Reduzierung der Emissionen von Zementöfen (hoher Aufwand, wenig Glamour) entschieden. Das Ergebnis war eine Art „Ingenieurstagnation“ in kritischen Infrastrukturbereichen.
Pfadabhängigkeit und Infrastruktureinschränkung: Unsere Städte und Systeme wurden um bestimmte Technologien herum aufgebaut (z. B. ölbetriebene Autos mit einem ausgedehnten Kraftstoffversorgungsnetz, Kohlekraftwerke, die stabile Netze speisen). Es ist eine Herausforderung, diese tief eingebetteten Systeme über Nacht zu verändern. Von einem 1990 gebauten Stahlwerk wurde erwartet, dass es mehr als 50 Jahre läuft; Unternehmen werden solche Anlagen nicht verschrotten, wenn sie nicht dazu gezwungen sind. Dieses „Lock-in“ begünstigt eher inkrementelle Verbesserungen (etwas bessere Kohleverbrennung, inkrementelle Effizienzsteigerungen) als „Moonshot“-Innovationen.
Die Folge dieser Faktoren war, dass wir zwar eine Revolution der Bits erlebten, der Bereich der Atome aber hinterherhinkte. Der Zeitraum von etwa 1970 bis 2020 könnte als eine Ära karikiert werden, in der wir (durch IT und Globalisierung) die Welt zwar vernetzt, aber nicht grundlegend umgestaltet haben. Die globalen Produktivitätsdaten spiegeln dieses Ungleichgewicht wider: Das verarbeitende Gewerbe und die Landwirtschaft verzeichneten zwar bescheidene Verbesserungen, aber keine vergleichbaren Zuwächse in der Größenordnung der Computerbranche. Die Energie- und Rohstoffindustrie dominierte weiterhin die Umweltverschmutzung und den Ressourcenverbrauch und arbeitete im Wesentlichen nach den Paradigmen des 20. Jahrhunderts.
Dieses Innovationsdefizit ist jedoch kein Schicksal. In den letzten Jahren hat eine Kombination von Faktoren – die Dringlichkeit des Klimawandels, sinkende Kosten für saubere Energie, politische Impulse (wie die Bepreisung von Kohlendioxid und die Förderung von Forschung und Entwicklung) und vielleicht eine neue Generation von Ingenieuren, die sich für Nachhaltigkeit engagieren – begonnen, die Trägheit der Schwerindustrie aufzubrechen. Wir können alles simulieren, aber wir können den Planeten nicht nachhaltig ernähren, was deutlich macht, dass die nächste Innovationsrevolution auf die physischen Bedürfnisse ausgerichtet sein muss. Jetzt, mit Verspätung, sehen wir die Anfänge dieser Revolution. Die Regierungen finanzieren Demonstrationsanlagen für grünen Stahl und Zement. Start-ups arbeiten am enzymbasierten Recycling von Kunststoffen. Die COVID-19-Pandemie und geopolitische Spannungen (z. B. Unterbrechungen der Versorgungskette, Sorgen um die Energiesicherheit) haben der Welt auch vor Augen geführt, wie wichtig belastbare lokale Produktions- und Ressourcenkreisläufe sind, und haben den Anstoß zu Innovationen in diesen grundlegenden Sektoren gegeben.
Kurz gesagt, die Innovationsdürre in den Kernindustrien hat endlich ein Ende. Im weiteren Verlauf dieses Artikels werde ich Beispiele aus der Praxis für sich anbahnende Durchbrüche beleuchten (um zu zeigen, dass ein grundlegender Wandel möglich ist) und dann erörtern, was noch nötig ist, um industrielle Systeme wirklich neu zu erfinden. Wir werden sehen, dass viele „alte“ Industrien an der Schwelle zu einem radikalen Wandel stehen – ein ermutigender Trend, denn ohne Innovation in der Art und Weise, wie wir Dinge produzieren, können wir nicht die umfassende Nachhaltigkeit erreichen, die unsere Zukunft erfordert.
Aktuelle Innovationen am Horizont: Umstrukturierung der Industrie für Nachhaltigkeit
Trotz der historischen Trägheit zeichnet sich jetzt rund um den Globus eine Welle aufkommender industrieller Lösungen ab. In Labors, Pilotanlagen und sogar einigen Großanlagen können wir die Umrisse eines neuen industriellen Paradigmas erkennen, das auf erneuerbaren Energien, Kreisläufen und Bionik beruht. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über einige der vielversprechendsten sektorspezifischen Innovationen, die von der Schwerindustrie über die Landwirtschaft bis hin zur Wasserinfrastruktur reichen. Jedes Beispiel zeigt, dass die Anpassung der Industrie an die natürlichen Kreisläufe nicht nur möglich, sondern bereits im Gange ist. Diese Beispiele weisen auch auf die Schlüssel für eine Ausweitung hin: politische Unterstützung, öffentlich-private Zusammenarbeit und kontinuierliche Forschung und Entwicklung.
Fossilfreier Stahl (Schweden und China):
Stahl und Zement sind für die moderne Gesellschaft unverzichtbar – und notorisch starke Umweltverschmutzer. Zusammen sind sie für etwa 15 % der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Für eine regenerative industrielle Zukunft ist es von zentraler Bedeutung, dass wir die Herstellung dieser Materialien verändern. Erfreulicherweise zeigen aktuelle Projekte in Europa und Asien einen Weg zu fossilfreiem Stahl und kohlenstoffneutralem Zement auf.
In Schweden hat die HYBRIT-Initiative – ein Gemeinschaftsunternehmen von SSAB (Stahlhersteller), LKAB (Eisenerzlieferant) und Vattenfall (Energieversorger) – die weltweit erste Pilotanlage zur Stahlerzeugung mit grünem Wasserstoff anstelle von Koks (Kohle) gebaut. Bei der herkömmlichen Stahlerzeugung wird Koks zur Reduktion von Eisenerz in einem Hochofen verwendet, wobei CO₂ freigesetzt wird. Das HYBRIT-Verfahren verwendet Wasserstoffgas (das durch Elektrolyse mit erneuerbaren Energien erzeugt wird), um Eisenerz zu „Eisenschwamm“ zu reduzieren, wobei Wasserdampf statt CO₂ freigesetzt wird. Dieser Eisenschwamm wird dann in einem elektrischen Lichtbogenofen (der ebenfalls mit sauberem Strom betrieben wird) geschmolzen, um Stahl herzustellen. Das Ergebnis ist ein Stahl mit einem Kohlenstoff-Fußabdruck von nahezu Null – etwa 90-95 % weniger CO₂-Emissionen als bei konventionellen Produkten. Im Jahr 2021 produzierte HYBRIT seine erste Charge fossilfreien Stahls, und 2022 begannen Unternehmen wie Volvo und Amazon Web Services (AWS) mit Pilotprojekten für den Einsatz in Lastwagen und Rechenzentren. Amazon Web Services ging sogar eine Partnerschaft mit SSAB ein, um HYBRIT-Stahl für die Fassadenpaneele neuer Rechenzentren in Schweden zu verwenden – der erste Einsatz von wasserstoffbasiertem Stahl beim Bau von Rechenzentren. Diese frühe Annahme durch einen Tech-Giganten bestätigt nicht nur die Qualität des Stahls, sondern signalisiert auch die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach kohlenstoffarmen Materialien.
Auf politischer Ebene hat die EU grünen Stahl stark unterstützt: Das HYBRIT-Demonstrationsprojekt erhielt einen Zuschuss von 143 Millionen Euro aus dem Europäischen Innovationsfonds. Diese Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, da grüner Wasserstoff und neue Öfen in der Größenordnung teuer sind. Experten weisen darauf hin, dass selbst ein weit verbreitetes Recycling (Elektrolichtbogenöfen auf Schrottbasis) nicht die gesamte künftige Stahlnachfrage befriedigen wird, so dass wir die Primärstahlproduktion sanieren müssen. Andere europäische Stahlhersteller (ArcelorMittal, Salzgitter) haben ähnliche wasserstoffbasierte Projekte auf den Weg gebracht.
In China, wo mehr als die Hälfte des weltweiten Stahls produziert wird, ist eine parallele Entwicklung im Gange. Anfang 2024 eröffnete das staatliche Unternehmen Baowu Steel in Zhanjiang, Guangdong, eine wasserstofftaugliche DRI-Anlage mit einer Kapazität von 1 Million Tonnen pro Jahr – der größte Reaktor dieser Art in China (Baosteel Mill Starts Energiron DRI Facility – Association for Iron & Steel Technology). In dieser neuen Anlage wird mit Wasserstoff angereichertes Erdgas (einschließlich Wasserstoff aus Kokereigas) zur Reduktion von Eisenerz verwendet, wodurch der Kohleverbrauch drastisch gesenkt wird. Die erste Produktion von direkt reduziertem Eisen wurde innerhalb von zwei Jahren nach Projektbeginn erreicht – ein beeindruckendes Tempo. Nach Angaben des Technologieanbieters Tenova handelt es sich bei dieser Anlage um den weltweit größten wasserstoffbasierten Reaktor für die Eisenerzeugung, der einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft für Stahl darstellt“, so der CEO von Tenova. Wichtig ist, dass die Anlage so konzipiert ist, dass sie im Laufe der Zeit auf die Verwendung von mehr Wasserstoff umgestellt werden kann, wenn die Verfügbarkeit steigt. Chinas nationales Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein, gibt den Anstoß für solche Projekte. Mit staatlicher Unterstützung und Pilotprojekten zum Kohlenstoffhandel plant China, die Wasserstoff-Eisenerzeugung zu replizieren und zu skalieren, wenn diese Demonstration erfolgreich ist.
Diese ersten Projekte in Schweden und China zeigen die technische Machbarkeit von grünem Stahl. Die verbleibende Herausforderung ist die Skalierung: Es gilt, genügend grünen Wasserstoff zu niedrigen Kosten zu produzieren und die Stahlkäufer dazu zu bewegen, (zumindest anfangs) einen Aufpreis für kohlenstoffärmeren Stahl zu zahlen. Politische Instrumente wie die Bepreisung von Kohlenstoff, die öffentliche Beschaffung von grünem Stahl (für Infrastrukturen usw.) und die internationale Zusammenarbeit zum Austausch bewährter Verfahren werden entscheidend sein. Wie eine Führungskraft aus der Branche es ausdrückte, sind diese Piloten so etwas wie der „Wright-Brothers-Moment“ für grünen Stahl – sie haben bewiesen, dass er fliegen kann – aber jetzt müssen wir die Boeing 747 dieser Technologie bauen. Die ermutigende Nachricht ist, dass der Flug begonnen hat.
Kohlenstoffneutraler Zement (Europa und Indien):
Die Hauptemissionen von Zement entstehen bei der chemischen Umwandlung von Kalkstein (CaCO₃) in Kalk (CaO), bei der CO₂ freigesetzt wird, und bei der Verbrennung von Brennstoffen zum Aufheizen der Öfen auf ca. 1450 °C. Um den Fußabdruck von Zement zu verringern, ist daher sowohl die Kohlenstoffabscheidung als auch die Umstellung auf andere Brennstoffe erforderlich. In Norwegen steht Heidelberg Materials (ehemals HeidelbergCement) kurz davor, das weltweit erste großtechnische System zur Kohlenstoffabscheidung in einem Zementwerk zu betreiben. In seinem Werk Brevik, das Teil des norwegischen Longship-CCS-Projekts ist, hat Heidelberg Anlagen zur Abscheidung von ca. 400 000 Tonnen CO₂ pro Jahr installiert – etwa 50 % der Emissionen des Werks. Ende 2024 ist das Projekt mechanisch abgeschlossen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird das abgeschiedene CO₂ verschifft und unter der Nordsee in der geologischen Speicherstätte Northern Lights gelagert. Mit diesem Projekt wird eine Netto-Null-Lösung für ein bestehendes Zementwerk nachgerüstet, und es ist eine Blaupause für die Branche. Bemerkenswert ist, dass die norwegische Regierung ~65 % der Kosten von Brevik finanziert hat, da sie dieses Projekt als wichtige Infrastruktur für eine kohlenstoffarme Zukunft anerkennt. Das Kunststück erforderte die Integration von Kohlenstoffabscheidungsanlagen ohne Unterbrechung der laufenden Produktion – was durch mehr als eine Million Stunden sorgfältiger technischer Arbeit erreicht wurde. Wenn Brevik erfolgreich ist, öffnet es die Tür für CCS in Zementwerken auf der ganzen Welt, insbesondere dort, wo geeignete CO₂-Speicher- oder -Nutzungsoptionen bestehen.
In Indien hat sich einer der weltweit größten Zementhersteller, Dalmia Cement, das Ziel gesetzt, bis 2040 kohlenstoffneutral zu sein. Dalmia verfolgt dabei eine zweigleisige Innovationsstrategie. Zum einen hat sich das Unternehmen mit dem britischen Unternehmen Carbon Clean Solutions zusammengetan, um in seinem Zementwerk in Tamil Nadu eine Anlage zur CO₂-Abscheidung zu errichten, die mit 500.000 Tonnen pro Jahr die größte in der Zementindustrie wäre (Dalmia Cement and Carbon Clean Solutions to build carbon capture facility in India | gasworld). Das für 2019 angekündigte Projekt zielt darauf ab, CO₂ aus Rauchgas abzuscheiden und entweder zu binden oder zu verwerten (zum Beispiel in Chemikalien). Zweitens setzt Dalmia bei den Emissionen an der Quelle an und testet einen gemeinsam mit dem schwedischen Unternehmen SaltX entwickelten Electric Arc Calciner (EAC). Dieses Pilotprojekt, das 2024 in Dalmias Werk in Odisha anlaufen soll, nutzt erneuerbaren Strom, um Kalkstein zu kalzinieren (d. h. CO₂ aus CaCO₃ freizusetzen), anstatt Kohle oder Gas zu verbrennen. Wenn ein elektrischer Kalzinator mit Solar-/Windkraft betrieben werden kann und mit CO₂-Abscheidung für das reine CO₂ aus Kalkstein kombiniert wird, könnten wir Zement mit minimalen Emissionen herstellen. Erste Studien deuten darauf hin, dass die elektrifizierte Kalzinierung, insbesondere in Verbindung mit der anschließenden Kohlenstoffabscheidung, den CO₂-Ausstoß von Zement drastisch senken könnte. ABB und andere Technologieunternehmen beteiligen sich ebenfalls an diesen Bemühungen, um die Automatisierung und Effizienz der EAC-Konstruktion zu verbessern. Diese Pilotprojekte sind die ersten Schritte auf dem Weg zu einer „fossilfreien“ Zementproduktion, und Dalmias Vorreiterrolle ist angesichts des riesigen und wachsenden Zementbedarfs in Indien von Bedeutung.
Die Innovationen in den Bereichen Stahl und Zement unterstreichen ein Thema: Die Schwerindustrie experimentiert endlich mit grundlegend neuen Produktionswegen (Wasserstoff statt Kohle, Strom statt Verbrennung, Abscheidung von Emissionen statt freiem Ausstoß). Jedes dieser Projekte steht im Einklang mit den natürlichen Kohlenstoffkreisläufen, indem es entweder die Freisetzung von neuem fossilem Kohlenstoff vermeidet oder CO₂ auffängt und remineralisiert. So kann beispielsweise CO₂ aus Zement in geologische Formationen eingeleitet werden, was die natürliche Speicherung von Kohlenstoff in Gesteinen nachahmt. Grüner Stahl vermeidet, dass fossiler Kohlenstoff überhaupt erst in den aktiven Kreislauf gelangt. Um diese Durchbrüche zu erzielen, sind unterstützende Ökosysteme erforderlich: Infrastrukturen für erneuerbare Energien (um grünen Strom und Wasserstoff in großem Maßstab bereitzustellen), Finanzierungsmechanismen (die in Teil 3 erörtert werden) und aktualisierte Normen (damit die Bauvorschriften kohlenstoffarmen Stahl und Zement umfassen). In diesen Bereichen gibt es erste Ansätze, z. B. bei der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung in Europa.
Kohlenstoffkreislauf und chemische Kreisläufe: Umwandlung von Emissionen in Produkte
Die Schwerindustrie wird nicht nur an der Quelle sauberer – sie findet auch Wege, um Kohlenstoffabfälle wiederzuverwenden und den Kreislauf zu schließen. Ein spannender Bereich ist die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) in Sektoren wie Chemie und Energie. Anstatt CO₂ als unwiederbringliches Nebenprodukt zu behandeln, fragen sich die Unternehmen: Kann CO₂ ein Rohstoff sein? Können wir Kohlenstoff aus Rauchgasen oder sogar aus der Atmosphäre entnehmen und daraus etwas Nützliches machen und so den natürlichen Kohlenstoffkreislauf imitieren?
Ein bahnbrechendes Pilotprojekt in China ist ein überzeugendes Beispiel. In der Provinz Zhejiang hat ein Kohlekraftwerk eine CO₂-Abscheidungsanlage installiert, die jährlich 15.000 Tonnen CO₂ aus dem Rauchgas auffängt und dieses CO₂ dann zur Aushärtung von Bauziegeln vor Ort verwendet. Während eines 72-stündigen Testlaufs fing das System 90 % des CO₂ aus dem Abgas mit einer Reinheit von 99 % ab. Es verwendet ein fortschrittliches Zweiphasen-Lösungsmittel, das <2,4 GJ Energie pro Tonne CO₂ benötigt – ein im Branchenvergleich relativ geringer Energieaufwand. Das abgeschiedene CO₂ wird dann in die Produktion von Porenbetonsteinen eingespeist: Das CO₂ reagiert mit den Kalziumverbindungen in den Steinen und bildet stabile Karbonatminerale, die den Kohlenstoff dauerhaft in fester Form einbetten. Etwa zwei Drittel des CO₂ werden für diese Ziegel verwendet, und das restliche Drittel wird zu Trockeneis in Lebensmittelqualität für Kühlhäuser verarbeitet. Das Ergebnis ist ein doppelter Gewinn: Die Emissionen des Kraftwerks werden reduziert, und das CO₂ wird zu einem wertvollen Rohstoff, der einen Teil des Zements/Branntkalks in den Ziegeln ersetzt, wodurch die Produktionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Ziegeln um schätzungsweise 2-5 chinesische Yuan pro Kubikmeter sinken. Ein Projektingenieur beschrieb es als „wie die Herstellung von Dampfbrot, aber wir verwenden CO₂ anstelle von Dampf zur Aushärtung der Ziegel“, was die Eleganz der konstruktiven Nutzung von Abgas unterstreicht.
Dieses chinesische Pilotprojekt, das von Forschern der Universität Zhejiang unterstützt wird, ahmt den natürlichen Kohlenstoffkreislauf auf beschleunigte Weise nach – und vollbringt in einer Fabrik in wenigen Stunden das, was geologische Prozesse über Jahrtausende hinweg tun (CO₂ in Gestein verwandeln) (research pt. 2.docx). Es zeigt, wie die Nutzung von Kohlenstoff sowohl Kohlenstoff binden als auch Produkte erzeugen kann. Ähnliche Initiativen gibt es auch anderswo: In Island mineralisiert Carbfix abgeschiedenes CO₂ in Basaltgestein; Unternehmen wie CarbonCure und Carbicrete in Nordamerika injizieren CO₂ in Betonmischungen, um diese zu stärken und gleichzeitig Kohlenstoff zu binden. Auch Start-ups stellen Polymere, Kraftstoffe und Düngemittel auf CO₂-Basis her. All dies entspricht der Idee einer kreislauforientierten Kohlenstoffwirtschaft, in der Kohlenstoff in geschlossenen Kreisläufen kontinuierlich recycelt und nicht in den Himmel geblasen wird.


Auch bei der direkten Abscheidung von CO₂ aus der Atmosphäre (Direct Air Capture, DAC) sind rasche Fortschritte zu verzeichnen. Im Jahr 2024 wird das Schweizer Unternehmen Climeworks in Hellisheidi, Island, „Mammoth„, die größte DAC-Anlage der Welt, in Betrieb nehmen. Mammoth ist darauf ausgelegt, jährlich 36.000 Tonnen CO₂ aus der Umgebungsluft abzuscheiden. Das ist fast eine Größenordnung mehr als die vorherige Orca-Anlage von Climeworks (die ~4.000 t/Jahr abfing). Das in Island abgeschiedene CO₂ wird mit Hilfe von Carbfix in den Untergrund verpresst, wo es mit Basalt reagiert und zu Stein wird – ein dauerhafter Speicher. Auch wenn 36.000 Tonnen immer noch ein winziger Tropfen auf den heißen Stein sind (die menschlichen Emissionen belaufen sich auf ca. 36 Milliarden Tonnen/Jahr), beweist Mammoth, dass die Skalierbarkeit von DAC-Anlagen zunimmt. Wie ein Klimawissenschaftler kommentierte: „Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein… aber ein viel größerer Tropfen als alles, was wir bisher gesehen haben.“ Die größte Herausforderung für DAC sind die Kosten und der Energieverbrauch: Heute können die Kosten in der Größenordnung von 500-600 Dollar pro Tonne CO₂ liegen, was für einen Masseneinsatz zu hoch ist (research pt. 2.docx). Forscher und Unternehmen streben jedoch eine Kostensenkung auf unter 150 $ oder sogar 100 $/Tonne an (research pt. 2.docx). Zu den Ideen gehören neue Sorptionsmaterialien (wie metallorganische Gerüste oder enzymbasierte Filter, die CO₂ effizienter aufnehmen) und die Nutzung von Abwärme oder billiger erneuerbarer Energie zum Antrieb des Prozesses.
Es ist bemerkenswert, wie schnell sich das Bild gewandelt hat: Vor einem Jahrzehnt wurde die Kohlenstoffabscheidung oft als Feigenblatt abgetan, um fossile Brennstoffe zu verlängern. Jetzt, mit Projekten wie Zhejiangs CO₂-to-bricks und Climeworks‘ Mammoth, sehen wir CCUS als eine Brücke zu einem regenerativen Kohlenstoffkreislauf. Diese Technologien erkennen im Wesentlichen an, dass wir über das natürliche Kohlenstoffgleichgewicht hinausgegangen sind und nun aktiv Kohlenstoff entfernen und neu verwenden müssen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Sie müssen in großem Maßstab eingesetzt werden – Experten schätzen, dass bis Mitte des Jahrhunderts Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr entfernt werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen – aber die ersten Beispiele sind bereits vorhanden. Die Integration von CCUS in Industriecluster (CO₂-Abscheidung aus Zement, Stahl und Chemikalien sowie die gemeinsame Nutzung von Transport- und Lagerungsinfrastrukturen) könnte zu Größenvorteilen führen. Innovationen wie CO₂-abgeleitete Baumaterialien, Kunststoffe oder sogar kohlenstoffnegative Kraftstoffe (hergestellt durch die Kombination von abgeschiedenem CO₂ mit grünem Wasserstoff) könnten zirkuläre Wertschöpfungsketten schaffen, die unseren Abfallkohlenstoff in eine Ressource verwandeln. In der Natur ist der Abfall eines Organismus der Input eines anderen; die menschliche Industrie beginnt, diesen Trick zu lernen.
Regenerative Landwirtschaft und Nährstoffrecycling
Die moderne Landwirtschaft war ein Segen für die Ernährung von Milliarden von Menschen, aber sie hat dabei die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe unterbrochen. Wir bauen weit mehr Nährstoffe ab und binden sie, als die Ökosysteme aufnehmen können, was zu Düngerabflüssen , die Flüsse und Küsten verschmutzen führt(Algenblüten, „tote Zonen“), während andere Regionen unter einer Verarmung der Bodennährstoffe leiden. Um eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen, müssen wir Nährstoffe effizienter nutzen und sie so recyceln, wie es die Natur in Ökosystemen tut (wo die Abfälle einer Art Nahrung für eine andere sind). Ermutigend ist, dass Innovationen von Indien bis Afrika den Weg zu einer Landwirtschaft weisen, die mit natürlichen Nährstoffkreisläufen zusammenarbeitet.


Präzisionsdünger und Nano-Nährstoffe (Indien und China):
Ein dramatisches Beispiel für Innovation bei der Verwendung von Düngemitteln kommt von Indiens größter Düngergenossenschaft IFFCO. Im Jahr 2021 brachte IFFCO den weltweit ersten Nano-Flüssigharnstoffauf den Markt – ein Düngemittelprodukt, bei dem Harnstoff (eine Stickstoffquelle) in Form einer Nanopartikelsuspension abgegeben wird. Eine winzige 500-ml-Flasche Nano-Harnstoff soll einen Standardsack mit 45 kg granuliertem Harnstoffdünger ersetzen. Die Logik dahinter ist, dass die Partikel in Nanogröße leicht von den Blättern aufgenommen werden können, wodurch sich der Anteil des Stickstoffs, den die Pflanze tatsächlich nutzt, erheblich erhöht. Normalerweise geht über die Hälfte des herkömmlichen Harnstoffdüngers verloren (verflüchtigt sich als Ammoniak, wird als Nitrat ins Wasser ausgewaschen usw.). Feldversuche in Indien haben gezeigt, dass der Einsatz von Nano-Harnstoff zu erheblichen Ertragssteigerungen führt, und das bei einer wesentlich geringeren Gesamtmenge an ausgebrachtem Stickstoff. Mitte 2023 hatte IFFCO die Produktion in mehreren Werken hochgefahren und produzierte Hunderttausende von Nanodüngerflaschen pro Tag. Das Unternehmen entwickelte auch Nano-DAP (Phosphatdünger) und einen verbesserten Nano-Harnstoff Plus mit 16 % Stickstoffgehalt (gegenüber 4 % in der ersten Version). Die indische Regierung hat Nanodünger in ihrer Düngemittelkontrollverordnung zugelassen und sie in Subventionsprogramme integriert, um die Akzeptanz zu fördern. Die Motivation ist sowohl ökologischer als auch wirtschaftlicher Natur: Reduzierung der enormen Düngemittelimporte und Subventionen (Indien gibt Milliarden für Harnstoffsubventionen aus) durch Verbesserung der Nährstoffaufnahme. Obwohl einige Agronomen zur Vorsicht mahnen, bis mehr unabhängige Daten gesammelt wurden (Nano“ bedeutet nicht automatisch wirksam unter allen Bedingungen), ist das Konzept sehr attraktiv. Mehr Pflanzen pro Tropfen Nährstoff bedeutet weniger Verschmutzung und weniger Ressourcenverschwendung. Es ist ein seltener Fall, in dem ein neues Effizienzniveau erreicht werden kann – ähnlich wie bei LED-Glühbirnen für die Beleuchtung.
China, das selbst mit dem Problem der übermäßigen Verwendung von Düngemitteln konfrontiert ist, setzt ebenfalls auf ein präzises Nährstoffmanagement. Das chinesische Landwirtschaftsministerium leitete in den 2010er Jahren Initiativen ein, um bis 2020 ein „Nullwachstum“ des Düngerverbrauchs zu erreichen, was auch erreicht wurde – im Wesentlichen wurde der Höchststand des chinesischen Düngerverbrauchs erreicht und leicht gesenkt, während die Ernteerträge erhalten blieben. Erreicht wurde dies durch eine Kombination von Maßnahmen: Bodentests zur Steuerung der Düngerausbringung, Förderung von Düngemitteln mit kontrollierter Freisetzung (Granulate, die beschichtet sind, um die Nährstoffe allmählich freizusetzen), Nitrifikationshemmer (zur Verringerung der Auswaschung und der N₂O-Emissionen) und eine bessere Aufklärung der Landwirte. Chinesische Unternehmen testen derzeit polymerbeschichteten Harnstoff und andere fortschrittliche Produkte, die die Nährstoffabgabe mit dem Bedarf der Pflanzen synchronisieren. Durch die Feinabstimmung des Zeitpunkts und der Form der Nährstoffabgabe wollen sie die Verluste, die als Wasserverschmutzung enden, verringern. Diese Bemühungen erinnern an ältere Techniken der Präzisionslandwirtschaft (wie die GPS-gesteuerte Ausbringung von Düngemitteln), fügen aber eine neue High-Tech-Dimension hinzu.
Nährstoffrückgewinnung und Recycling (Europa und Afrika):
Auf der Recyclingseite des Nährstoffkreislaufs gibt es spannende Fortschritte bei der Rückverwandlung von „Abfall“ in Dünger. Die Europäische Union hat erkannt, dass der Phosphorkreislauf unterbrochen ist – Europa importiert Phosphor in Form von Futter- und Düngemitteln und verschwendet dann einen Großteil davon (in Form von Tierdung und menschlichen Abwässern), der letztlich das Wasser verschmutzt oder auf Deponien landet (Die Bewältigung der globalen Phosphorherausforderung wird die Ernährungssicherheit verbessern und die Verschmutzung verringern ). Um dieses Problem anzugehen, hat die EU 2024 ihre Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser aktualisiert, um zum ersten Mal die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Phosphor vorzuschreiben. Innerhalb von drei Jahren werden für die Mitgliedstaaten spezifische Ziele für die Wiederverwendung und das Recycling von Phosphor festgelegt. Dieser regulatorische Vorstoß hat bereits Projekte in Gang gesetzt. In Deutschland zum Beispiel schreibt eine neue Verordnung vor, dass bis 2029 alle großen Kläranlagen Phosphor aus Klärschlamm zurückgewinnen müssen. Als Reaktion darauf baut eine Partnerschaft unter der Leitung von EasyMining (einem schwedischen Cleantech-Unternehmen) und Gelsenwasser (einem deutschen Energieversorger) die erste Ash2Phos-Anlage im großen Maßstab in Deutschland. Diese Anlage in Schkopau wird die Asche von verbranntem Klärschlamm verarbeiten (der Rückstand nach der Verbrennung von Klärschlamm zur Abfallreduzierung) und über 90 % des Phosphors extrahieren. Der zurückgewonnene Phosphor wird in mineralischer Form (Kalziumphosphat) vorliegen, die zur Herstellung von neuem Dünger verwendet werden kann. Die Anlage erhielt ihre Genehmigung im Jahr 2023 und soll 2027 in Betrieb gehen. Die Kapazität beträgt etwa 30 000 Tonnen Asche pro Jahr, die Tausende von Tonnen Phosphat ergeben. Dieses „Kreislaufphosphat“ wird den Bedarf an abgebautem Phosphatgestein aus Ländern wie Marokko (das derzeit einen großen Teil der Reserven hält) verringern. Außerdem wird verhindert, dass der in der Asche enthaltene Phosphor verloren geht oder die Umwelt verschmutzt. EasyMining berichtet, dass bei dem Verfahren auch nützliche Nebenprodukte wie Eisen (das zu Eisenchlorid für die Wasseraufbereitung wird) und Aluminium gewonnen werden, was die Wirtschaftlichkeit erhöht. Das Mandat der deutschen Regierung hat im Grunde über Nacht einen Markt für P-Rückgewinnungstechnologien geschaffen – ein überzeugendes Beispiel dafür, dass Rechtsvorschriften Innovationen anregen.
In Afrika südlich der Sahara, wo synthetischer Dünger teuer und für die Landwirte oft knapp ist, wird das Nährstoffrecycling durch organische Kreislaufsysteme angegangen. Ein herausragendes Beispiel ist Sanergy in Kenia (das Düngemittelgeschäft wurde kürzlich in Regen Organics umbenannt). Sanergy geht zwei Probleme auf einmal an: den Mangel an sanitären Einrichtungen in den Slums und den Bedarf an erschwinglichem Dünger. Das Unternehmen stellt „Fresh Life“-Containertoiletten in den informellen Siedlungen Nairobis auf und sammelt die menschlichen Abfälle zusammen mit Tonnen anderer organischer Abfälle (Speisereste, Marktabfälle) aus der Stadt ein. In einer Verarbeitungsanlage setzen sie Larven der Schwarzen Soldatenfliege ein, um diese Abfälle biologisch umzuwandeln. Die Fliegenlarven fressen die organischen Stoffe und entwickeln sich zu fetten Puppen, die dann geerntet und getrocknet werden, um ein proteinreiches Tierfutter zu erzeugen (das von Fisch- und Geflügelzüchtern verwendet wird). Die verbleibenden Reste (Frass und kompostiertes Material) werden zu einem organischen Dünger mit dem Namen „Evergrow“ weiterverarbeitet. Dieser Dünger ist reich an Nährstoffen und organischen Stoffen, die die Bodengesundheit verbessern. Bis 2023 sammelte und verarbeitete Sanergy wöchentlich Hunderte von Tonnen Abfall und erzeugte wertvolle Produkte, anstatt diese Abfälle zu Methan oder schmutzigem Wasser werden zu lassen. Eine Umfrage unter kenianischen Landwirten, die Evergrow nutzen, ergab, dass 84 % über ein höheres Einkommen und 92 % über eine bessere Lebensqualität berichteten – viele berichteten über höhere Ernteerträge und Einsparungen durch den geringeren Kauf von chemischen Düngemitteln. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass organisches Recycling die Produktivität der Landwirtschaft steigern kann. Es handelt sich im Wesentlichen um kommunales Bio-Recycling in großem Maßstab, ähnlich wie in der traditionellen Landwirtschaft in kleinem Maßstab (Gülleverwendung usw.), aber mit moderner Insektentechnologie und Lieferkettenlogistik.
Das Modell von Sanergy hat „geduldiges Kapital“ von Investoren wie Finnfund (Finnische Entwicklungsfinanzierungsinstitution) angezogen, weil es dreifachen Nutzen bringt: bessere Abwasserentsorgung (öffentliche Gesundheit), geringere Treibhausgasemissionen aus Abfällen und verbesserte Ernährungssicherheit. Die größten Hürden für die Ausweitung ähnlicher Modelle in anderen Städten sind die Finanzierung der ersten Anlagen und die Überwindung des „Ekelfaktors“ (öffentliche Wahrnehmung der Verwendung von Dünger aus menschlichen Abfällen). Die Einstellung ändert sich jedoch, wenn die Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen ist. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zertifizierung solcher organischen Düngemittel holen auf – die Regierungen beginnen damit, Standards festzulegen, damit Produkte wie Struvit (ein aus Abwasser ausgefälltes Phosphatmineral) oder Futtermittel auf Insektenbasis sicher gehandelt werden können.
Die umfassendere Vision ist, dass die Nährstoffkreisläufe auf regionaler Ebene geschlossen werden können. Stellen Sie sich vor, jede Stadt würde zu einer Düngerquelle und nicht zu einer Senke. Phosphor, der in einem Teil der Welt aus einem Phosphatgestein gewonnen wird, könnte nach der Verwendung in landwirtschaftlichen Betrieben und der Passage durch unseren Körper auf recycelten Wegen wieder auf den Feldern landen, anstatt in den Gewässern zu versickern. Dies würde die globale Ressourcensicherheit erhöhen (die Phosphorreserven sind endlich und geografisch konzentriert) und die Umweltschäden verringern. Europas Schritte und Kenias Beispiel sind komplementär: das eine ist hochtechnologisch und politisch motiviert, das andere ist low-tech und unternehmerisch. Beide zeigen, dass „Abfall“-Nährstoffemit Hilfe von Innovationen in wertvolle Inputs umgewandelt werden können, so dass eine Kreislaufwirtschaft entsteht, die dem endlosen Recycling von Elementen in der Natur entspricht.
Wasser und hydrologische Innovationen: Arbeiten mit dem Wasserkreislauf
Wasser ist das Lebenselixier der Ökosysteme und der Gesellschaft, aber die menschliche Entwicklung hat den Wasserkreislauf schwer gestört. Mit Beton bedeckte Städte können den Regen nicht aufnehmen, was zu Überschwemmungen führt; die Überbeanspruchung von Flüssen und Grundwasserleitern führt zu Dürre und ökologischem Zusammenbruch; und der Klimawandel verschärft die Extreme (stärkere Stürme, längere Trockenperioden). Um unsere Widerstandsfähigkeit zu verbessern, müssen wir die Art und Weise, wie wir Wasser ernten, nutzen und recyceln, erneuern und uns dabei an natürlichen Systemen orientieren. Hier kommen die Konzepte der „Schwammstädte“, der fortschrittlichen Entsalzung und der zirkulären Wassernutzung ins Spiel. Überall auf der Welt finden Wasserinnovatoren Wege, überschüssiges Wasser aufzufangen, wenn es verfügbar ist, es zu speichern oder umzuleiten und Wasser wiederzuverwenden, das früher verschwendet wurde.


„Schwammstädte“
Durch die rasche Verstädterung wird natürliches, durchlässiges Land häufig durch Beton und Asphalt ersetzt, was dazu führt, dass Niederschläge direkt in die Kanalisation fließen, diese überfluten und Sturzfluten verursachen. Außerdem wird die Grundwasserneubildung verhindert und es entstehen städtische Hitzeinseln. Im Jahr 2015 startete China eine ehrgeizige „Sponge City“-Initiative, um diese Probleme anzugehen, indem urbane Landschaften so umgestaltet werden, dass sie wie Schwämme wirken – sie saugen das Regenwasser auf, filtern es und verwenden es an Ort und Stelle wieder. Die Regierung wählte 30 Pilotstädte aus (darunter Metropolen wie Shanghai, Wuhan und Chongqing) und investierte über 12 Milliarden Dollar in Tausende kleinerer grüner Infrastrukturprojekte. Dazu gehören: Regengärten und Bioswales entlang von Straßen, um den Abfluss zu absorbieren; durchlässige Straßenbeläge, die das Wasser in den Untergrund versickern lassen; begrünte Dächer auf Gebäuden (der Shanghaier Bezirk Lingang beispielsweise baute 4,3 Millionen Quadratmeter begrünte Dächer); angelegte Feuchtgebiete und Rückhaltebecken in Stadtparks, um das Regenwasser zurückzuhalten; und die Wiederherstellung von Seen und Flussbetten, die kanalisiert worden waren. Die Sponge-City-Richtlinien sehen vor, dass 70-80 % des Regenwassers vor Ort aufgefangen oder wiederverwendet werden. Einige Pilotprojekte haben beeindruckende Zwischenergebnisse vorzuweisen. In Lingang wurden durch die Kombination von begrünten Dächern, durchlässigen Oberflächen und einem intelligenten Entwässerungssystem mit Sensoren die Abflussspitzen deutlich reduziert und ein Puffer gegen Überschwemmungen geschaffen. In Chongqing wurden Echtzeitsensoren und steuerbare Wasserschleusen unter Straßen installiert, um den Abfluss bei starken Regenfällen zu regulieren. Neben der Eindämmung von Überschwemmungen verbessern diese Maßnahmen auch die Wasserqualität (Pflanzen und Böden filtern Schadstoffe), fördern städtische Grünflächen und die Artenvielfalt und kühlen sogar die Stadt (durch Verdunstungskühlung und Schatten).
Ein anschauliches Beispiel ist Wuhan, eine Stadt, die seit jeher anfällig für Überschwemmungen ist. Im Rahmen des Pilotprojekts „Schwammstadt“ hat Wuhan Dutzende von Seen und Teichen angelegt oder wiederhergestellt und sie mit Parks und durchlässigen Grünflächen verbunden. Bei starkem Regen werden diese Gebiete sicher überflutet (wie es bei Feuchtgebieten der Fall sein soll) und halten das Wasser zurück, das sonst die Straßen überschwemmen würde. Das gespeicherte Wasser versickert dann langsam oder wird zur Wiederverwendung (zur Bewässerung oder zur Reinigung für den kommunalen Gebrauch) abgepumpt. Dieser Ansatz ist das Gegenteil der konventionellen städtischen Wasserwirtschaft des 20. Jahrhunderts, bei der es darum ging, das Wasser so schnell wie möglich abzuleiten. Jahrhunderts, bei dem es darum ging, das Wasser so schnell wie möglich abfließen zu lassen. Stattdessen heißt es: „Lasst das Wasser verweilen“ – gebt ihm Raum, sich auszubreiten und zu versickern wie in einem Wald, anstatt es in Betonkanäle zu leiten.
Das Konzept der Schwammstädte breitet sich nun international aus. Städte wie Kopenhagen und Rotterdam haben nach Überschwemmungskatastrophen Schwammelemente eingebaut – z. B. Kopenhagens „Wolkenbruch-Boulevards“, die bei starkem Regen als Flutkanäle dienen und das Wasser in Parks leiten, die als Wasserbecken konzipiert sind. In den USA ist der Plan für grüne Infrastruktur in Philadelphia im Wesentlichen eine Schwammstadt-Strategie zur Verringerung von Überläufen in der Kanalisation. Die größten Herausforderungen bei der Verbreitung von Sponge-City-Praktiken sind die institutionellen Kosten und die Kosten für die Nachrüstung. Für bestehende dichte Städte kann es schwierig sein, Flächen für Grünanlagen zu gewinnen. Auch die Pflege der verteilten grünen Infrastruktur (Freihaltung der Abflüsse, Gesunderhaltung der Pflanzen) erfordert koordinierte Anstrengungen. Die Pilotprojekte in China haben gezeigt, dass einige Städte sich auf auffällige Projekte konzentrieren, aber nicht auf vernetzte Systeme, oder dass die lokalen Regierungen an Schuldengrenzen stoßen. Aber das sind Kinderkrankheiten; die zugrunde liegende Idee hat sich bewährt. Finanzierungsmechanismen wie Resilienzanleihen oder Regenwassergebühren können diese Projekte unterstützen. Viele Experten gehen davon aus, dass Versicherungs- und Finanzsektoren bei steigenden Klimarisiken schwammartige Maßnahmen bevorzugen werden, weil sie langfristige Schäden verringern. Es ist bemerkenswert, dass naturbasierte Lösungen wie diese im Vergleich zu massiver grauer Infrastruktur (z. B. riesige Sturmtunnel) oft kostengünstig sind. Außerdem bieten sie einen Zusatznutzen – schönere Städte, urbane Lebensräume -, den die Bürger zu schätzen wissen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der Innovation der Schwammstädte darum geht, wieder zu lernen, mit dem Wasser zu leben, anstatt es einfach zu bekämpfen.
Mit erneuerbaren Energien betriebene Entsalzung (Marokko und darüber hinaus):
Während es in den Städten zu viel Wasser gibt, leiden viele Regionen unter Wasserknappheit. Die Entsalzung von Meerwasser ist für trockene Küstenregionen (vom Mittleren Osten bis nach Kalifornien) zu einem Rettungsanker geworden. Herkömmliche Entsalzungsanlagen sind jedoch extrem energieintensiv und werden häufig mit fossilen Brennstoffen betrieben, was zu hohen Kohlenstoffemissionen und Kosten führt. Eine neue Generation von Projekten zielt darauf ab, die Entsalzung von diesem schweren Fußabdruck zu entkoppeln, indem sie mit erneuerbaren Energien betrieben wird und die Effizienz verbessert. Ein Vorzeigebeispiel ist die Entsalzungsanlage Agadir in Marokko. Die 2021 fertiggestellte Anlage ist eine der weltweit größten kombinierten Entsalzungsanlagen für Trink- und Bewässerungswasser mit einer Kapazität von 275.000 Kubikmetern pro Tag (150.000 m³ für Haushaltswasser und 125.000 m³ für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Betriebe in der nahe gelegenen Chtouka-Ebene). Entscheidend ist, dass es zu 100 % mit Solar- und Windenergie aus dem marokkanischen Netz betrieben wird. Marokko hat in der Nähe der Atlantikküste massiv in Wind- und Solarparks investiert, so dass die Entsalzungsanlage kontinuierlich mit sauberem Strom betrieben werden kann. Auf diese Weise wird der enorme CO₂-Fußabdruck vermieden, der normalerweise mit der Entsalzung verbunden ist (die Entsalzung verursacht weltweit erhebliche CO₂-Emissionen, wenn sie mit fossilem Strom betrieben wird). Die Anlage in Agadir verwendet fortschrittliche Umkehrosmose-Membranen und Energierückgewinnungsgeräte, um den Energieverbrauch pro Kubikmeter zu senken. Die Auswirkungen sind für die Region von großer Bedeutung: Die Anlage bietet eine zuverlässige Wasserquelle für mehr als eine halbe Million Menschen in Agadir und stabilisiert die Wasserversorgung für 15 000 Hektar Ackerland, während sich die überlasteten Grundwasserleiter erholen und erholen können. Landwirte, die das Grundwasser erschöpften (und damit die Brunnen versalzten), können nun entsalztes Wasser verwenden, dem ein Teil des Grundwassers beigemischt ist, was ein weiteres Eindringen von Meerwasser und eine Verschlechterung der Bodenqualität verhindert. Im Wesentlichen trägt die erneuerbare Entsalzung zur Wiederherstellung des lokalen Wasserkreislaufs bei, indem sie die Grundwasserleiter auf einem nachhaltigen Niveau hält und das durch den Klimawandel bedingte Niederschlagsdefizit ausgleicht.
Auch in den Staaten am Persischen Golf (Saudi-Arabien, VAE) werden solarbetriebene Entsalzungsanlagen erprobt. In Dubai beispielsweise wird der riesige Jebel-Ali-Entsalzungskomplex durch PV-Anlagen ergänzt, um einen Teil des Energieverbrauchs auszugleichen. In Saudi-Arabien gibt es ein Projekt, bei dem ein großer PV-Park direkt mit einer Entsalzungsanlage gekoppelt wird, um billiges, emissionsfreies Süßwasser zu produzieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien für die Entsalzung ist ein logischer Schritt in Regionen mit viel Sonne, aber wenig Wasser.
Die Entsalzung birgt noch weitere Umweltprobleme: Soleabfälle (konzentriertes Salzwasser) können Meeresökosysteme schädigen, wenn sie unsachgemäß entsorgt werden, und hohe Betriebskosten können die öffentlichen Finanzen belasten. Um diese Probleme zu bewältigen, werden derzeit Innovationen entwickelt. Einige Forschungsprojekte zielen darauf ab, die Sole abzubauen, d. h. Mineralien zu extrahierenwie Salz, Magnesium und sogar Lithium (für Batterien) aus der Sole , Abfall in eine Ressource zu verwandeln und den Salzgehalt der Abwässer zu verringern. Dieses Konzept des „Abbaus von Ozeanen“ könnte die Kosten ausgleichen und Entsorgungsprobleme lösen, wenn es effizient durchgeführt wird. Andere Bemühungen konzentrieren sich auf neue Membranmaterialien (z. B. Filter auf Graphenbasis), die den Energieverbrauch senken könnten, oder auf kleine dezentrale Entsalzungsanlagen, die durch netzunabhängige erneuerbare Energien für abgelegene Gemeinden betrieben werden.
Die Wasserkrise ist dringlich: Experten warnen, dass die weltweite Süßwassernachfrage das nachhaltige Angebot übersteigen wirdbis 2030 . Diese Lücke muss durch eine Kombination aus besserem Wassermanagement, Wiederverwendung und neuen Angeboten wie Entsalzung geschlossen werden. Das Weltwirtschaftsforum stellte unverblümt fest, dass wir Wasser als globales Gemeingut behandeln und die Effizienz drastisch verbessern müssen. Die mit sauberer Energie betriebene Entsalzung ist ein Teil dieses Puzzles – im Wesentlichen eine Anleihe aus dem Meer und der Sonne, um die strapazierten Süßwasserquellen an Land zu entlasten.
Wasserrecycling und Wiederverwendung
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Behandlung von Abwasser nicht als Abfall, sondern als wertvolle Ressource. Führende Städte zeigen, dass praktisch alle Abwässer gereinigt und wiederverwendet werden können, wodurch ein städtischer Wasserkreislauf entsteht. Windhoek, Namibia und Singapur sind berühmte Pioniere der direkten Wiederverwendung von Trinkwasser – sie verwandeln Abwasser durch fortschrittliche Aufbereitung (mehrstufige Filtration, Umkehrosmose, UV-Desinfektion) in Trinkwasser. Singapurs NEWater-Programm deckt ~40 % seines Wasserbedarfs durch die Wiederaufbereitung von Abwasser nach höchsten Reinheitsstandards, wodurch die Abhängigkeit von Wasserimporten verringert wird. Mit diesem Ansatz wird der Kreislauf zwischen städtischem Wasserverbrauch und Grundwasseranreicherung geschlossen.
Das Haupthindernis für eine stärkere Wiederverwendung ist häufig die öffentliche Wahrnehmung – die mentale Blockade „Toilette zu Wasser“. Deshalb sind Aufklärung und das Aufzeigen von Sicherheit so wichtig. Nach jahrelanger Öffentlichkeitsarbeit hat eine Umfrage in Windhoek im Jahr 2019 gezeigt, dass die Einwohner ihr Wiederverwendungssystem stark unterstützen, weil sie dem strengen Verfahren und den Tests, die dahinter stehen, vertrauen. Technologisch gesehen kann die moderne Aufbereitung (Membranbioreaktoren, fortschrittliche Oxidationsverfahren wie Ozon+UV) selbst Spuren von Arzneimitteln und Mikroverunreinigungen entfernen, was das wiederaufbereitete Wasser extrem sicher macht – oft sauberer als herkömmlich aufbereitetes Wasser aus Flüssen. Angesichts des sich abzeichnenden Wasserstresses wird sich das Abwasserrecycling von einer Nische zur Norm entwickeln. Neue Gebäude werden mit doppelten Sanitäranlagen ausgestattet sein (so dass Grauwasser aus Waschbecken getrennt und für die Spülung oder den Garten wiederverwendet wird). Die Industrie beginnt, ihre eigenen Abwässer vor Ort zu behandeln und wiederzuverwenden, um die Zufuhr aus Flüssen zu verringern. Israel recycelt bereits ~90 % seines Abwassers für die Landwirtschaft – ein leuchtendes Beispiel dafür, was mit der richtigen Infrastruktur und Politik möglich ist (sie stellen gereinigtes Abwasser für die Bewässerung zu niedrigen Kosten zur Verfügung, was die Landwirte in diesem trockenen Land begrüßen).
Im Wesentlichen ahmt eine Kreislaufwasserwirtschaft den Wasserkreislauf der Natur nach: Niederschlag auffangen, nutzen, filtern und wiederverwenden, immer und immer wieder, wobei nur das verloren geht, was verdunstet oder in Produkten enthalten ist. Dadurch werden Flüsse und Grundwasserleiter weniger belastet, und es bleibt mehr für die Ökosysteme übrig. Eine Stadt, die einen großen Teil ihres Wassers wiederverwerten kann, ist weniger abhängig von unvorhersehbaren Regenfällen.
Alle diese Wasserinnovationen – Schwammstädte, Entsalzung, Wiederverwendung – haben eines gemeinsam: Sie arbeiten mit natürlichen Systemen und Kreisläufen. Grüne Infrastrukturen arbeiten mit natürlicher Infiltration und Verdunstung. Erneuerbare Entsalzung arbeitet mit dem Klima (Sonnenschein), um klimabedingte Dürre zu beheben. Die Wiederverwendung von Wasser schließt Kreisläufe wie Ökosysteme (Feuchtgebiete reinigen schließlich auf natürliche Weise Wasser). Je mehr wir diese Konzepte einbeziehen, desto näher kommen wir einem Gleichgewicht, in dem die menschliche Wassernutzung die Umwelt nicht mehr erschöpft oder verschmutzt. Da Wasserkrisen (Überschwemmungen, Dürren, Knappheit) zu den unmittelbarsten Klimarisiken der kommenden Jahrzehnte gehören, ist die Skalierung solcher Lösungen dringend erforderlich. Die Technologie ist weitgehend vorhanden; was noch fehlt, sind Integration, Investitionen und gesellschaftliche Akzeptanz.
Kritische Innovationen sind noch nötig: Schließung der Regelkreise in großem Maßstab
Nachdem wir uns einen Überblick darüber verschafft haben, was es bereits gibt und was sich abzeichnet, wenden wir uns nun den Lücken zu – den entscheidenden Innovationen, die noch benötigt werden, um diesen industriellen Wandel zu vollenden. Es gibt nach wie vor Bereiche, in denen die derzeitige Technologie noch nicht ausreicht, um vollständige Nachhaltigkeit zu erreichen. In Teil 3 werden wir über diese Pionierherausforderungen und die Art der bahnbrechenden Innovationen spekulieren, die künftige Labore und Forschungseinrichtungen liefern müssen.
Trotz aller Fortschritte bei Pilotprojekten und Nischenanwendungen gibt es kritische Problembereiche, für die wir noch keine angemessenen Lösungen haben. Dies sind die „weißen Flecken“ für Innovationen in den kommenden Jahrzehnten – Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, um industrielle Kreisläufe vollständig zu schließen und globale Nachhaltigkeit zu erreichen. In diesem Abschnitt werden einige der wichtigsten ungelösten Probleme aufgezeigt: von der Entfernung von Kohlenstoff im Gigatonnen-Maßstab über das vollständige Recycling wichtiger Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor bis hin zur Neuerfindung von Werkstoffen und chemischen Prozessen, die keine Abfälle erzeugen. Die Bewältigung dieser Aufgaben wird wahrscheinlich Durchbrüche in Wissenschaft und Technik erfordern – die Art von „Moonshot“-Innovationen, die sich noch in der frühen Forschungsphase befinden oder noch nicht erfunden wurden. Wir erörtern, warum jeder einzelne Punkt von entscheidender Bedeutung ist und welche potenziellen Wege (wenn auch spekulativ) es gibt, um diese Probleme anzugehen.
Entfernung von Kohlenstoff in klimarelevantem Maßstab
Selbst wenn wir Industrie und Energie dekarbonisieren, machen Klimamodelle eines deutlich: Wir haben so viel CO₂ in die Atmosphäre gepumpt, dass ein Emissionsstopp allein möglicherweise nicht ausreicht. Um die globale Erwärmung auf 1,5-2°C zu begrenzen, müssen laut IPCC bis Mitte des Jahrhunderts jedes Jahr Milliarden Tonnen CO₂ aus der Luft entfernt werden. Dies ist eine enorme Herausforderung. Derzeit bewältigt die größte Anlage zur direkten Abscheidung aus der Luft (Mammoth von Climeworks) 0,036 Millionen Tonnen/Jahr, und die gesamte weltweite DAC-Kapazität beträgt nur ein paar Tausend Tonnen – im Grunde ein Rundungsfehler im Verhältnis zu den Emissionen. Die Kohlenstoffsenken der Natur (Wälder, Böden, Ozeane) absorbieren einen Teil des CO₂, aber wir können uns nicht allein auf die Anpflanzung von Bäumen verlassen, um Milliarden von Tonnen zu binden, vor allem nicht unter Klimastress. Daher müssen wir wahrscheinlich ganz neue Industrien für die Kohlenstoffbindung schaffen.
Durch welche Art von Innovation könnte eine CO₂-Entfernung im Gigatonnenbereich pro Jahr erreicht werden?
Ein Weg ist die radikal verbesserte Direct Air Capture (DAC)-Technologie. Die heutigen DAC-Systeme verwenden feste Sorptionsmittel oder flüssige Lösungsmittel, um die ~0,04 % CO₂ in der Luft zu binden, und dann Energie (normalerweise Wärme), um das CO₂ freizusetzen und zu konzentrieren. Das ist energieaufwändig, weil CO₂ verdünnt ist. Ein Durchbruch könnte durch neue Materialien erreicht werden – zum Beispiel durch Sorptionsmittel, die bei der Regeneration weit weniger Wärme benötigen oder die CO₂ selektiv und effizienter abscheiden. Forscher untersuchen elektrochemische DAC-Verfahren, die Elektrizität (die erneuerbar sein könnte) nutzen, um CO₂ bei niedrigeren Temperaturen abzuscheiden, oder photokatalytische Materialien, die Sonnenlicht direkt nutzen könnten, um CO₂-Abscheidungsreaktionen anzutreiben. Es wird auch an Enzymen oder synthetischen Membranen gearbeitet, die die biologische Kohlenstoffbindung nachahmen. Japans „Moonshot“-Forschungsprogramm hat das Ziel, Membranen mit „ultrahoher CO₂-Selektivität und -Durchlässigkeit“ zu entwickeln – im Wesentlichen ein künstliches Blatt, das CO₂ kostengünstig aus der Luft filtert. Wenn es gelingt, solche Membranen oder Enzymsysteme zu entwickeln, könnten DAC-Anlagen viel kompakter und energieeffizienter werden, was die Kosten pro Tonne drastisch senken würde (in Richtung des Bereichs unter 100 Dollar, der der heilige Gral ist).
Die Mineralisierung von Kohlenstoff ist eine weitere vielversprechende Strategie zur Entfernung, die noch der Innovation bedarf. Wir wissen, dass bestimmte Mineralien (wie Silikatgestein) mit CO₂ reagieren und feste Karbonate bilden – auf diese Weise schließt die Natur das CO₂ im Laufe der geologischen Zeit ein. Bei der verstärkten Verwitterung wird reaktionsschnelles Gestein (wie Olivin) zerkleinert und das Pulver auf Böden oder Strände gestreut, wo es mit dem im Regenwasser gelösten CO₂ aus der Atmosphäre reagiert. Studien zeigen, dass dies den Boden verbessern und Kohlenstoff binden kann, aber die Reaktion ist immer noch relativ langsam und erfordert das Bewegen und Zerkleinern einer großen Menge an Gestein. Die Technologie könnte helfen, indem sie Wege findet, die Kinetik zu beschleunigen – vielleicht mit Hilfe von Katalysatoren oder speziellen Mikroben, die die Karbonisierung von Mineralien fördern. Ein anderer Ansatz besteht darin, CO₂ in geeignete Gesteinsformationen zu injizieren und es dort mineralisieren zu lassen (wie bei Carbfix in Island, wo injiziertes CO₂ in weniger als zwei Jahren in Basaltformationen zu Stein wurde). Um dies in größerem Maßstab zu erreichen, sind möglicherweise fortschrittliche Bohrmethoden erforderlich, um den Kontakt von CO₂ mit reaktivem Gestein im Untergrund zu verbessern, oder wir müssen weltweit Gesteinsarten finden, die als CO₂-Schwämme dienen können. Es gibt Forschungsarbeiten über die Zugabe von Substanzen zu injiziertem CO₂, um dessen Ausbreitung und Reaktion in Porenräumen zu verbessern.
Die direkte Abscheidung aus dem Ozean ist eine neue Idee, die an Interesse gewinnt. Die Ozeane enthalten 50-mal mehr CO₂ als die Atmosphäre (meist in Form von Bikarbonationen). Wenn wir dem Meerwasser CO₂ entziehen, zieht der Ozean die gleiche Menge aus der Luft ab (aufgrund des Gleichgewichts). Das bedeutet, dass wir den Ozean als einen riesigen Puffer für DAC nutzen könnten. Zu den vorgeschlagenen Methoden gehören elektrochemische Prozesse, die das Gleichgewicht zwischen Karbonat und Bikarbonat in Richtung Freisetzung von CO₂-Gas für die Abscheidung verschieben (wodurch das Wasser alkalischer wird, was sogar der Versauerung der Ozeane entgegenwirken könnte). Ein Konzept besteht darin, erneuerbare Elektrizität zu nutzen, um Meerwasser aufzuspalten und einen Strom aus Säure und Base zu erzeugen. Durch die Zugabe der Base zum Meerwasser wird Bikarbonat in Karbonat umgewandelt und es werden Mineralien ausgefällt (die Kohlenstoff speichern), während der Säurestrom genutzt werden kann, um CO₂ kontrolliert zur Abscheidung freizusetzen. Es gibt noch keine kommerziellen Anlagen zur direkten Abscheidung aus dem Meer, aber einige Start-ups arbeiten daran. Wenn wir das CO₂ im Wesentlichen aus dem Meerwasser „absaugen“ können, könnte das Ausmaß enorm sein (da das Wasser kontinuierlich verarbeitet werden kann). Es sind jedoch Innovationen erforderlich, um dies effizient und umweltverträglich zu machen – wir müssen sicherstellen, dass wir keine lokalen pH-Wert-Verluste verursachen oder das Leben im Meer schädigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für eine klimarelevante CO₂-Entfernung wahrscheinlich eine Kombination der oben genannten Maßnahmen erforderlich ist: fortschrittliche DAC-Maschinen, verbesserte natürliche Systeme und meeresbasierte Methoden. Jedes dieser Verfahren ist mit technischen und kostspieligen Hürden verbunden, aber angesichts des Klimazwangs ist dies ein Bereich, der reif für einen globalen Innovationswettlauf ist. In einem Bericht heißt es, dass wir innerhalb weniger Jahrzehnte von „ein paar tausend Tonnen auf 10 Milliarden Tonnen“ kommen müssen (research pt. 2.docx). Das ist vergleichbar mit dem Aufschwung ganzer Industrien wie Öl und Gas im 20. Jahrhundert, nur umgekehrt. Jahrhundert, aber in umgekehrter Richtung. Es bedarf großer Investitionen in Forschung und Entwicklung (einige haben ein „Manhattan-Projekt für die Kohlenstoffentfernung“ gefordert (research pt. 2.docx)), politischer Unterstützung (um Märkte für Kohlenstoffentfernungsgutschriften oder -mandate zu schaffen) und öffentlicher Akzeptanz (um große Anlagen zu finanzieren und zu betreiben). Das Ermutigende daran ist, dass die CO₂-Entfernung im Grunde ein lösbares technisches Problem ist – der Kohlenstoff ist vorhanden, wir kennen Wege, ihn abzuscheiden und umzuwandeln, es geht nur darum, es besser, billiger und schneller zu machen. Die nächsten großen Durchbrüche in der Materialwissenschaft oder der chemischen Technik könnten durchaus auf diese große Herausforderung ausgerichtet sein.
Den Stickstoffkreislauf in Ordnung bringen: Düngung der Zukunft ohne Verschmutzung
Stickstoff ist ein Element des Lebens – in Proteinen, in der DNA, im Chlorophyll -, aber unsere Methode, Pflanzen mit Stickstoff zu versorgen (Kunstdünger), ist ein zweischneidiges Schwert. Die Erfindung der Haber-Bosch-Ammoniaksynthese war ein Wunder des 20. Jahrhunderts, das die Nahrungsmittelproduktion in die Höhe trieb und Milliarden von Menschen ernährte, aber sie hatte einen hohen Preis: Für die Herstellung von Wasserstoff werden riesige Mengen an Erdgas (oder Kohle) verbraucht, was zu ~1-2 % der weltweiten CO₂-Emissionen beiträgt, und sie hat Ökosysteme mit reaktivem Stickstoff überflutet, was zu Wasserverschmutzung und Lachgasemissionen führt. Das Ergebnis ist ein Stickstoffkreislauf, der weit aus dem Gleichgewicht geraten ist: Flüsse, die durch Algen aus dem Abfluss verstopft sind, sauerstoffarme Küstengebiete und ein starkes Treibhausgas (N₂O), das sich in der Atmosphäre anreichert. Gibt es einen besseren Weg für das nächste Jahrhundert? Wir müssen den Stickstoff für Nutzpflanzen ohne diese Nebenwirkungen bereitstellen und die landwirtschaftlichen Stickstoffströme im Wesentlichen an den viel langsameren, kontrollierten Stickstoffkreislauf der Natur anpassen.
Eine kühne Vision ist die Entwicklung von Nutzpflanzen, die ihren eigenen Stickstoff binden aus der Luft können, ähnlich wie Leguminosen (Bohnen, Erbsen) dies über symbiotische Bakterien in Wurzelknöllchen tun. Stellen Sie sich große Getreidearten wie Weizen, Reis oder Mais vor, die keinen synthetischen Stickstoffdünger mehr benötigen, weil sie mit Mikroben zusammenarbeiten oder über die genetische Maschinerie verfügen, um N₂ aus der Atmosphäre zu ziehen (das zu 78 % aus N₂-Gas besteht) und es intern in Ammoniak umzuwandeln. Dies ist seit Jahrzehnten ein Traum der Biotechnologie. Es ist eine außerordentliche Herausforderung, denn die biologische Stickstofffixierung ist komplex – das Enzym Nitrogenase, das dafür verantwortlich ist, umfasst viele Gene und funktioniert nur unter sauerstofffreien Bedingungen (die Leguminosen durch die Aufnahme von Bakterien in spezialisierten Knöllchen lösen). Es werden jedoch Fortschritte erzielt. Die Forscher versuchen mehrere Ansätze:
- Übertragung von symbiotischen Stoffwechselwegen: Übertragung der notwendigen Gene von stickstofffixierenden Bakterien oder Leguminosen auf Getreide. Zum Beispiel, indem man einer Pflanze wie Reis die Gene hinzufügt, die Nodulation und Fixierung ermöglichen. Dadurch könnte Reis in der Lage sein, Bakterien in seinen Wurzeln zu beherbergen, die für ihn Stickstoff fixieren. Es ist teilweise gelungen, Getreide dazu zu bringen, Beziehungen zu stickstofffixierenden Bakterien aufzubauen, aber eine vollständige Integration ist schwer zu erreichen.
- Künstlich hergestellte endophytische Bakterien: Statt die Pflanze stark zu verändern, besteht ein anderer Ansatz darin, Bakterien zu züchten oder zu selektieren, die im Inneren der Pflanze (in den Wurzeln oder sogar in den Stängeln) leben und einen Teil des Ammoniaks an die Pflanze abgeben können. Es gibt Versuche, bei denen bestimmte Bakterienstämme auf Mais aufgebracht werden, die dann Stickstoff produzieren. Erste kommerzielle Produkte (wie die Beschichtung von Saatgut mit N-fixierenden Mikroben) sollen den Düngerbedarf um etwa 30 % senken, obwohl unabhängige Daten noch begrenzt sind.
- Synthetische Biologie in Pflanzenzellen: Wissenschaftler wie das Voigt-Labor am MIT haben daran gearbeitet, das eigentliche Nitrogenase-Enzymsystem in pflanzeneigene Zellen (wie Chloroplasten oder Mitochondrien) einzubauen (research pt. 2.docx). Sie haben einen Meilenstein erreicht, indem sie die Schlüsselkomponenten der bakteriellen Nitrogenase in Hefe und Pflanzenmitochondrien exprimieren konnten. Dies deutet darauf hin, dass es möglich sein könnte, eine Pflanzenzelle zu schaffen, die in der Lage ist, N₂ zu fixieren, wenn wir alle Teile zusammenbringen können. Das wäre so, als würde man die Pflanze mit einer Stoffwechsel-Superkraft ausstatten, die normalerweise nur bestimmte Mikroben haben. Es ist noch ein langer Weg – es ist eine der schwierigsten Aufgaben in der Pflanzengentechnik – aber wenn es gelingt, wäre es revolutionär: Pflanzen, die sich buchstäblich selbst mit Stickstoff aus der Luft versorgen.
Diese Bemühungen sind wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt oder mehr von der Feldreife entfernt, aber sie stellen die Spitze der Angleichung der Landwirtschaft an die Natur dar. Hülsenfrüchte und ihre Freunde, die Rhizobienbakterien, tun dies schon seit langem; wir versuchen, dieses Geschenk auf Nicht-Hülsenfrüchte auszuweiten.
Ein weiterer „Moonshot“ ist die elektrochemische Stickstoffreduktion (e-NRR), bei der die Haber-Bosch-Methode völlig übersprungen und Ammoniak direkt aus N₂ und Wasser hergestellt wirdmit Hilfe von Strom in einem Schritt . Dies ist wie ein „künstliches Blatt“, das Ammoniak anstelle von Zucker produzieren würde. Die Forscher haben nach Elektrokatalysatoren gesucht, die dies leisten können. Bisher ist die Ausbeute extrem gering – Stickstoff ist hartnäckig träge. Wenn jedoch ein bahnbrechender Katalysator gefunden wird (z. B. ein neuartiges Material oder eine von Enzymen inspirierte Elektrode), könnten Landwirte buchstäblich ein koffergroßes Gerät vor Ort haben, das mit Hilfe von Sonnenenergie Dünger aus Luft und Wasser produziert. Das wäre für Kleinbauern eine große Umstellung und würde den Bedarf an riesigen zentralen Düngemittelanlagen (und deren Emissionen) überflüssig machen. Das ist spekulativ, aber ein zunehmend heißes Forschungsthema in der Chemie.
Neben der Produktion gibt es noch das Problem des überschüssigen reaktiven Stickstoffs, der bereits in der Umwelt vorhanden ist. Der jahrzehntelange übermäßige Einsatz von Düngemitteln hat dazu geführt, dass viele Grundwasserleiter mit Nitraten verseucht sind und die Böden überschüssigen Stickstoff enthalten, der ausgewaschen wird. Bei der Sanierung sind Innovationen gefragt: zum Beispiel Denitrifikationsbioreaktoren – einfache, mit Holzspänen gefüllte Gruben, die anoxische Zonen schaffen, in denen Bakterien Nitrat in N₂-Gas zurückverwandeln. Diese werden in landwirtschaftlichen Entwässerungssystemen erprobt. Aber wie kann man sie in großem Maßstab in der Landschaft einsetzen? Vielleicht könnten wir Drohnen oder Grabenfräsen einsetzen, die systematisch Hackschnitzelfilter entlang von Wasserläufen installieren. Oder vielleicht mehr Hightech: Einige Start-ups schlagen elektrochemische Zellen vor, die Nitrat aus dem Wasser entfernen und es sogar wieder in Ammoniakdünger umwandeln können, um den Kreislauf zu schließen. Das Auffangen und Recyceln von Nitrat würde die Verschmutzung flussabwärts verhindern und einen Mehrwert schaffen. Solche Systeme müssen kosteneffizient sein, damit sie auf breiter Basis eingesetzt werden können (vielleicht mit Unterstützung von Wasserschutzprogrammen oder Wasserversorgungsunternehmen).
Kurz gesagt, die Behebung des Stickstoffkreislaufs erfordert sowohl Innovationen auf der Quellenseite (neue Wege, um den Stickstoff ohne Emissionen zu den Pflanzen zu bringen) als auch Innovationen auf der Senken-Seite (Umgang mit den Altlasten und Leckagen von Stickstoff in der Umwelt). Wenn uns das gelingt, könnten wir künftige Bevölkerungen mit einem Bruchteil des ökologischen Fußabdrucks ernähren. Stellen Sie sich vor, dass Reisfelder weder Methan noch Lachgas ausstoßen, weil der Reis Stickstoff bindet und die Bodenmikroben im Gleichgewicht sind; stellen Sie sich vor, dass das Grundwasser überall sicher zu trinken ist, weil die Nitratverschmutzung der Vergangenheit angehört. Dies ist sowohl eine ökologische als auch eine technische Aufgabe – es geht darum, Agrarökosysteme so umzugestalten, dass sie mehr wie natürliche Ökosysteme funktionieren, die einen engen Nährstoffkreislauf haben. Dies ist eine multidisziplinäre Herausforderung, die Genetik, Mikrobiologie, Agronomie und Technik miteinander verbindet. Aber es steht viel auf dem Spiel: Die Veränderung des Stickstoffkreislaufs durch den Menschen ist eine der planetarischen Grenzen, die wir überschritten haben, in ihrem Ausmaß vergleichbar mit dem Klimawandel. Es ist für ein stabiles Erdsystem von entscheidender Bedeutung, diesen Kreislauf wieder in Einklang zu bringen.
Den Kreislauf von Phosphor (und anderen Nährstoffen) schließen
Über Phosphor (P) wird nicht so viel berichtet wie über Kohlenstoff oder Stickstoff, aber er ist ebenso wichtig. Jede Zelle braucht Phosphor (man denke nur an das Rückgrat der DNA und die ATP-Energiemoleküle). Die moderne Landwirtschaft ist in hohem Maße auf Phosphatdünger angewiesen, der aus endlichen Gesteinsvorkommen gewonnen wird. Das Problem: Phosphor wird unglaublich ineffizient eingesetzt, und es gibt keine atmosphärische Komponente, die ihn global recycelt (im Gegensatz zu Stickstoff oder Kohlenstoff). Wir bauen P ab und bringen es auf den Feldern aus; die Pflanzen nehmen einen Teil davon auf, aber ein großer Teil fließt ins Wasser ab oder sammelt sich in unbrauchbaren Formen im Boden an. Überschüssiges P im Wasser verursacht Algenblüten und tote Zonen, während gleichzeitig Landwirte in ärmeren Regionen keinen Zugang zu Düngemitteln haben und ihre Böden einen P-Mangel aufweisen. Außerdem konzentrieren sich die weltweiten Phosphatreserven auf einige wenige Länder (allein Marokko verfügt über ~70 % der bekannten Reserven), was geopolitische und langfristige Versorgungsprobleme aufwirft (research pt. 2.docx).
Um einen nachhaltigen Phosphorkreislauf zu erreichen, müssen wir das Phosphorrecycling drastisch erhöhen und Verluste reduzieren. Dies ist zum Teil eine Frage der Politik und der Praxis (wie bereits bei den EU-Verordnungen und Projekten wie Ash2Phos erörtert). Aber es gibt auch noch technologische Lücken zu schließen:
Eine davon ist die kostengünstige dezentrale P-Rückgewinnung. Große Kläranlagen können in Verfahren wie die Struvit-Fällung (Bildung von Magnesium-Ammonium-Phosphat-Kristallen, die als Dünger verwendet werden können) investieren – und einige tun dies auch. Aber was ist mit dem riesigen P in ländlichen Gebieten (z. B. in Klärgruben) oder in Tierdüngern? Wir brauchen vielleicht miniaturisierte P-Auffangvorrichtungen. Stellen Sie sich einen Kläranlagenaufsatz vor, der P (und vielleicht N) auffängt, bevor das Abwasser versickert. Dabei könnte es sich um eine Kartusche mit einem speziellen Sorptionsmittel handeln, die von Hausbesitzern regelmäßig ausgetauscht wird, wobei die verbrauchte Kartusche an einen Recycler geht. Einige Forscher erforschen spezielle Filtermaterialien (wie eisenbeschichtete Biokohle oder spezielle Ionenaustauscherharze), die Phosphat stark aus dem Wasser binden und später zur Wiederverwendung freigeben können. Wenn diese billig genug hergestellt werden können, könnten sie in landwirtschaftlichen Entwässerungsgräben, Lagunen oder sogar als Filter-„Socken“ an Abflussstellen auf dem Feld eingesetzt werden. Eine Innovation in der Materialwissenschaft (z. B. ein recycelbarer Phosphatschwamm mit hoher Affinität ) könnte hier einen entscheidenden Beitrag zum Auffangen diffuser Phosphorverluste leisten.
Ein weiteres Gebiet ist die Gewinnung von „Alt-Phosphor“ in den Böden. Nach jahrzehntelangem Einsatz von Düngemitteln enthalten viele landwirtschaftliche Böden in Europa, Nordamerika und China große Mengen an Phosphor, der für Pflanzen nicht ohne Weiteres verfügbar ist (er ist an Mineralien gebunden, die von den Pflanzen nicht aufgenommen werden können). Wenn wir auch nur einen Teil davon freisetzen könnten, könnten wir den Bedarf an neuen Düngemitteln senken. Dies könnte durch Bio-Innovation erreicht werden: Bestimmte Mikroben oder Pflanzenwurzelausscheidungen können gebundene Phosphate auflösen. Die Erforschung des Bodenmikrobioms könnte Inokulanzien (wie bestimmte Bakterien oder Pilze) hervorbringen, die P für die Pflanzen besser verfügbar machen. Einige Biodüngerhersteller verkaufen bereits phosphatauflösende Bakterien, doch die Ergebnisse sind unterschiedlich. Fortgeschrittenere Ansätze könnten darin bestehen, Pflanzen gentechnisch so zu verändern, dass sie organische Säuren oder Enzyme ausscheiden, die P aus der Bodenbank freisetzen. Im Grunde genommen könnten wir die historischen Anreicherungen in den landwirtschaftlichen Betrieben „abbauen“, anstatt mehr hinzuzufügen.
Wir verlieren auch viel P durch Abfluss und Erosion. Sedimente von den Feldern tragen Phosphor in die Flüsse. Das Auffangen von erodiertem Boden, bevor er den Betrieb verlässt (durch Pufferstreifen, Sedimentteiche) und die anschließende Umverteilung dieses Sediments zurück auf die Felder ist eine Art Geoengineering, das eingesetzt werden könnte. Oder, eine verrückte Idee: Algenzucht in nährstoffverschmutztem Wasser könnte das Wasser reinigen und P auffangen. Wenn ein See aufgrund der Verschmutzung reich an Algen ist, könnte man diese Algen (die den aufgenommenen P enthalten) ernten und zu Dünger verarbeiten. Bei einigen Projekten zur Sanierung von Seen werden überschüssige Wasserpflanzen oder Algen geerntet und als Kompost verwendet – ein manueller Kreislaufschluss.
Neben P und N gibt es noch weitere Nährstoffe, bei denen zirkuläres Denken gefragt ist. Kalium (K) ist ein weiteres abgebautes Düngemittel, das zwar häufiger vorkommt als P, dessen Recycling aber irgendwann von Bedeutung sein wird (Holzasche oder Ernterückstände enthalten K, das zurückgeführt werden könnte). Sogar Elemente wie Schwefel, der oft ein Nebenprodukt von Raffinerien ist, könnten im Boden besser verwertet werden, wenn gereinigte Formen zur Verfügung stehen (interessanterweise wird mit der Reinigung der Emissionen fossiler Brennstoffe weniger Schwefel in die Luft abgegeben und auf den Böden abgelagert, so dass einige Gebiete jetzt Schwefeldünger benötigen – ein seltsamer Nebeneffekt der Reduzierung der Umweltverschmutzung).
In industriellen Prozessen gehen viele Spurenmineralien und Katalysatoren verloren oder werden vergeudet. Das Ideal der Zukunft ist die Entwicklung von Verfahren, bei denen jedes Element entweder in einem geschlossenen Kreislauf verbleibt oder in eine unschädliche Form umgewandelt wird. Nehmen wir zum Beispiel seltene katalytische Metalle, die in der chemischen Industrie verwendet werden – heute geht ein Teil des Katalysatormaterials mit der Zeit verloren und landet im Abfall. Wir brauchen abfallfreie Katalysatoren, die entweder unbegrenzt halten oder zu 100 % zurückgewonnen und recycelt werden können. Dies könnte neue Katalysatorträger oder magnetische Katalysatoren bedeuten, die sich leicht abtrennen lassen, oder die Umstellung auf Biokatalysatoren (Enzyme), die in Wasser funktionieren und keine giftigen Rückstände bilden.
Apropos enzymbasiertes Recycling: Ein spannender Bereich ist der Einsatz maßgeschneiderter Enzyme, um komplexe Abfälle (wie Kunststoffe) in wiederverwendbare Bausteine zu zerlegen. Kürzlich haben Wissenschaftler Enzyme entdeckt und entwickelt, die PET-Kunststoff in seine Monomere zerlegen können, was ein biologisches Recycling von Kunststoffen in einem geschlossenen Kreislauf ermöglicht. Die Ausweitung dieses Verfahrens auf andere Polymere (Nylon, Polypropylen) könnte zur Lösung des Problems der Kunststoffabfälle beitragen. Enzyme sind spezifisch – sie können unter milden Bedingungen auf eine bestimmte chemische Bindung abzielen. Wenn wir enzymbasierte Recyclinganlagen in die Abfallwirtschaft einbinden könnten (stellen Sie sich vor, Sie werfen Polyesterkleidung in eine Anlage, die sie enzymatisch depolymerisiert, so dass das Polyester neu gesponnen werden kann), würde ein reversibler Materialkreislauf entstehen. Wir würden Materialien nicht als trägen Abfall behandeln, sondern als Molekülansammlungen, die endlos zerlegt und wieder zusammengesetzt werden können.
Der Gedanke der reversiblen Materialkreisläufe ist sehr inspirierend. Er sieht eine Zukunft vor, in der Produkte von Anfang an so konzipiert sind, dass sie leicht wieder in Rohstoffe zerlegt werden können – sei es mit mechanischen, chemischen oder biologischen Mitteln. Metalle können unendlich oft recycelt werden, wenn sie gesammelt werden (dafür brauchen wir einen besseren städtischen Abbau von Elektroschrott). Glas ist leicht zu recyceln. Kunststoffe und Verbundwerkstoffe sind schwieriger, aber die neue Polymerchemie könnte eine Depolymerisation ermöglichen. Sogar Elektronik könnte modular aufgebaut sein, so dass Komponenten ausgetauscht oder wiederverwertet werden können (es gibt Fortschritte beim Design von „zirkulärer Elektronik“). Die grüne Chemie zielt auf Prozesse ab, bei denen keine gefährlichen Abfälle anfallen – z. B. durch die Verwendung von Katalysatoren, die nur das gewünschte Produkt und unschädliche Nebenprodukte (wie Wasser) erzeugen.
Um den Kreislauf aller Materialien wirklich zu schließen, werden wir wahrscheinlich viele Innovationen im gesamten Periodensystem benötigen. Aber jeder Schritt bringt uns einer Wirtschaft näher, die wie ein Ökosystem funktioniert – wo alles wiederverwendet wird und Abfälle aus einem Prozess als Rohstoff für einen anderen dienen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die entscheidenden Innovationen, die noch benötigt werden, von Hightech (synthetische Biologie für stickstoffbindende Pflanzen, Nanomaterialien für die CO₂-Abscheidung) bis hin zu systemischen Innovationen (integrierte Wassernetze, Kreislaufprinzipien) reichen. Sie betreffen die schwierigsten Glieder der Kette, die noch nicht nachhaltig sind. Ihre Verwirklichung ist unerlässlich, um von den heutigen vielversprechenden Pilotprojekten zu einem regenerativen Industriesystem in vollem Umfang überzugehen. Die ermutigende Nachricht ist, dass das Erkennen dieser Lücken der erste Schritt ist; eine Welle von Forschungs- und unternehmerischen Aktivitäten ist bereits auf viele dieser Herausforderungen gerichtet, oft mit ausdrücklichem „missionsorientiertem“ Rahmen (wie Mission-Innovation-Herausforderungen zur Kohlenstoffbeseitigung oder Unternehmensverpflichtungen, Kunststoffe bis 2040 kreislauffähig zu machen, usw.).
Future Labs und kollaborative Forschung: Beschleunigung der Innovation durch Zusammenarbeit
Diese Innovationen „erfinden sich jedoch nicht von selbst“. Sie erfordern nachhaltige F&E-Investitionen, kühne Experimente und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen und Sektoren. An dieser Stelle kommt eine Initiative unseres Projekts Industrielle Renaissance ins Spiel. Im Rahmen dieses Projekts plant Themis Foresight die Durchführung mehrerer „Future Labs“ – spezielle Räume, um über den aktuellen Stand der Technik hinauszudenken und die nächste Generation von Lösungen zu entwickeln.
Wie können wir die oben beschriebenen Durchbrüche erzielen? Ein bewährter Ansatz besteht darin, unterschiedliche Köpfe – Industrieveteranen, junge Ingenieure, Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger – in einem konzentrierten, kreativen Problemlösungsumfeld zusammenzubringen. Themis Foresight leistet mit seinen „Future Labs“ Pionierarbeit bei diesem Ansatz. Dabei handelt es sich nicht um Labore im herkömmlichen Sinne, sondern um moderierte Innovationsworkshops und Denkwerkstätten, in denen Zukunftsszenarien simuliert und umsetzbare Ideen entwickelt werden. Future Labs sind ein Format, das Themis Foresight in verschiedenen Kontexten erprobt hat, und wir schlagen nun vor, es auf die große Herausforderung der regenerativen Industrie anzuwenden.
Ein Future Lab findet zu einem bestimmten Thema statt (z. B. „Dekarbonisierung von Zement“ oder „Phosphorrecycling in städtischen Gebieten“) und umfasst eine Gruppe verschiedener Interessengruppen: Vordenker aus der Industrie, akademische Forscher (Professoren oder Doktoranden), talentierte Studenten oder junge Berufstätige aus dem Ingenieurwesen, politische Experten und oft auch einen Querdenker wie einen Science-Fiction-Autor oder einen Designer. Die Mischung ist gewollt – wir wollen eine gegenseitige Befruchtung der Erfahrungen und neue Perspektiven. Während einer intensiven Sitzung (es kann sich um einen mehrtägigen Workshop oder eine Reihe von Treffen handeln) wird die Gruppe durch zukunftsorientierte Übungen geführt: Szenarien für 20 oder sogar 50 Jahre, Backcasting zur Ermittlung von Innovationspfaden, Brainstorming unter Zwang usw. Das angestrebte Ergebnis ist kein vager Talkshop, sondern konkrete Fahrpläne oder Projektkonzepte, die dann weiterverfolgt werden können.


Der zentrale Wert der Future Labs liegt darin, Silos aufzubrechen und die kreative Zusammenarbeit zu fördern. So weiß ein Branchenexperte vielleicht: „Wir haben X und Y ausprobiert und sind damit gescheitert, hier ist der Grund dafür“, während ein junger Ingenieur vielleicht eine neue Technik (KI-Modellierung, ein neuartiges Material) einbringt, die es vorher noch nicht gab – kombiniert man diese beiden, findet man vielleicht eine neue Lösung für ein altes Problem. Oder ein politischer Entscheidungsträger erklärt, welche Art von Regulierung auf uns zukommen wird, und leitet die Techniker an, ihre Lösungen darauf abzustimmen. Diese interdisziplinären Funken sind es, die oft zur Innovation führen.
Wir freuen uns sehr, dass wir eine Partnerschaft mit der Futuring Alliance eingegangen sind, um diese Future Labs zu organisieren und zu ermöglichen.
Ein weiteres Element ist das Testen von Annahmen durch Experten-Feedback-Schleifen. Wenn eine Laborgruppe beispielsweise vorschlägt: „Wir sollten Satelliten und KI nutzen, um Düngemittel gezielt einzusetzen“, schalten wir einen Experten für Satellitenfernerkundung ein (oder haben ihn vorab befragt), um schnell zu prüfen, was der Stand der Technik ist und welche neuen Innovationen erforderlich sein könnten (vielleicht Sensoren mit höherer Auflösung oder eine bessere Integration von Bodendaten). Auf diese Weise wird verhindert, dass zukunftsweisende Ideen zu abstrakt bleiben; sie basieren auf dem aktuellen Wissensstand und sind dennoch zukunftsorientiert.
Bei den Future Labs von Themis Foresight geht es auch um die Schaffung kontinuierlicher Praxisgemeinschaften. Wir veranstalten nicht nur einen Workshop und lösen uns dann auf. Wir veröffentlichen die Ergebnisse, laden die Teilnehmer zur weiteren Zusammenarbeit ein (oft bringen wir Start-ups mit Investoren oder Forscher mit Industriepartnern zusammen) und integrieren die Ergebnisse in unseren größeren Fahrplan für die industrielle Renaissance. Im Laufe der Zeit entwickeln wir mit mehreren Labors, die sich auf verschiedene Bereiche (Energie, Werkstoffe, Landwirtschaft, Finanzen) konzentrieren, eine umfassende Vision, die von Hunderten von Fachleuten vermittelt wird. Es handelt sich um eine Art offenes Innovationsnetzwerk, das auf große Herausforderungen ausgerichtet ist, die eine einzelne Einrichtung nicht allein lösen könnte.
Entscheidend ist, dass die Labore nicht nur theoretisch sind. Unser Ziel ist es, konkrete Pilotprojekte ins Leben zu rufen. Ein Future Lab zum Thema „urbane Nährstoffrückgewinnung“ könnte beispielsweise mit einem Plan für ein Pilotprojekt zur Urinableitung und Struvitrückgewinnung in einem Wohnkomplex in einer bestimmten Stadt enden (da menschlicher Urin viel Phosphor enthält). Das Labor würde aufzeigen, wer daran beteiligt sein muss (das städtische Versorgungsunternehmen, ein Sanitärunternehmen, ein Wohnungsanbieter, Wissenschaftler, die die Ergebnisse überwachen), und Themis Foresight kann dann dabei helfen, dieses Pilotprojekt zu initiieren, indem es die Beteiligten zusammenbringt und die Finanzierung (vielleicht über einen Zuschuss oder ein Impact Investment) ermittelt. Im Wesentlichen schaffen die Labs eine Pipeline von Demonstrationsprojekten, die Konzepte in kleinem Maßstab erproben können, bevor sie skaliert werden.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die in Future Labs gefördert wird, hilft auch, Synergien zu entdecken. Ein Labor zum Thema „CO₂-Nutzung“ könnte einen Zementhersteller mit einem Chemieunternehmen zusammenbringen und sie erkennen lassen, dass sie gemeinsam CO₂ aus Zementöfen zur Herstellung von Chemikalien verwenden könnten, was nicht auf der Hand lag, als jeder seinen eigenen Bereich isoliert betrachtete. In diesen sektorübergreifenden Partnerschaften liegen oft verborgene Chancen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Future Labs von Themis Foresight dazu dienen, Innovationen zu beschleunigen, indem sie die richtigen Leute zusammenbringen, provokante zukunftsorientierte Fragen stellen und die kreative Energie in konkrete Lösungen und Partnerschaften kanalisieren. Sie dienen als Mini-Innovationsmotoren innerhalb des umfassenderen Projekts Industrial Renaissance.
Mit der Ausweitung dieser Labore laden wir weitere Mitstreiter ein: Unternehmen, die der Zeit voraus sein wollen (und vielleicht neue Geschäftszweige aus diesen Ideen entwickeln), Universitäten, die ihre Studenten mit realen Herausforderungen konfrontieren wollen, öffentliche Einrichtungen, die nach neuen politischen Ansätzen suchen, und Finanziers, die an den nächsten nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten interessiert sind. Jedes Labor ist eine Gelegenheit, eine Dynamik für unsere industrielle Renaissance zu schaffen und das Ökosystem mit Ideen und Verbindungen zu versorgen, die in den kommenden Jahren Früchte tragen werden.
Schlussfolgerung:
Zum Abschluss von Teil 2 des Projekts „Industrielle Renaissance“ ist die Botschaft von dringendem Optimismus geprägt. Dringend, weil die Uhr im Hinblick auf den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Erschöpfung der Ressourcen tickt – das nächste Jahrzehnt ist entscheidend, um die Kurven zu biegen. Aber auch optimistisch, weil wir zum ersten Mal eine klare Vorstellung davon haben, wie sich die Industrie verändern kann, um nicht nur den Schaden zu verringern, sondern unsere Umwelt aktiv wiederherzustellen, und wir sehen die ersten Anzeichen dieses Wandels in Aktion. Die falsche Wahl zwischen „Wirtschaft und Umwelt“ wird von Innovatoren durchbrochen, die zeigen, dass wir beides haben können: florierende Industrien und einen gesunden Planeten.
Die Beispiele und Ideen, die wir untersucht haben, zeigen, dass eine andere industrielle Zukunft möglich ist. Eine, in der ein Stahlwerk Wasserdampf statt CO₂ ausstößt, in der die Abfälle einer Stadt zu ihrem eigenen Dünger und Brennstoff werden, in der landwirtschaftliche Betriebe üppig und produktiv sind, ohne Flüsse zu entwässern oder Nährstoffe auszuwaschen, und in der Wohlstand nicht mit Umweltverschmutzung einhergeht. Dies ist keine naive Fantasie – es ist eine Vision, die gerade jetzt von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Unternehmern und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt entwickelt wird. Teil 1 dieser Serie hat die alten Erzählungen in Frage gestellt; Teil 2 hat die neue Erzählung der regenerativen Innovation skizziert. Teil 3 wird sich eingehend mit Vorschlägen zur Finanzierung dieses grundlegenden Wandels der Industrie befassen.
Eine industrielle Renaissance, wie sie in dieser Artikelserie skizziert wird, ist ein globales Projekt, das wohl größte kollektive Unterfangen des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Jeder hat eine Rolle zu spielen: Regierungen, die die Richtung und die Anreize vorgeben, Unternehmen, die neue Technologien einsetzen und vermarkten, Geldgeber, die den Wandel vorantreiben, Forscher, die die verbleibenden harten Nüsse knacken, und Bürger, die sich für diese Innovationen einsetzen und sie annehmen. Vom Umfang her ähnelt sie der ursprünglichen industriellen Revolution – nur dass sie dieses Mal bewusst gestaltet wird, um sicherzustellen, dass sie mit den Lebenserhaltungssystemen der Erde vereinbar ist.
Wir laden Sie, den Leser, ein, Teil dieser industriellen Renaissance zu sein. Ob Sie nun eine Führungskraft in der Wirtschaft, ein Student, ein politischer Entscheidungsträger oder ein Investor sind, Ihre Perspektive und Ihre Talente werden gebraucht. Laden Sie unser Projektexposé herunter (verfügbar auf der Website von Themis Foresight), um sich eingehender mit den Möglichkeiten der Beteiligung zu befassen. Teilen Sie es mit Kollegen und in Ihren Netzwerken, um das Thema zu verbreiten.
Themis Foresight steht bereit, um zusammenzukommen, Verbindungen herzustellen und gemeinsam etwas zu schaffen. Die Herausforderung ist immens, aber wie wir gezeigt haben, ist auch die Chance groß. Indem wir die Maschinen der Industrie neu erfinden, können wir eine neue Ära des nachhaltigen Wohlstands einleiten – eine wahre industrielle Renaissance, die als der Moment in die Geschichte eingehen wird, in dem die Menschheit ihren Weg zur Harmonie mit unserer einzigen Heimat gefunden hat. Machen wir uns an die Arbeit.
Exposé zum Projekt